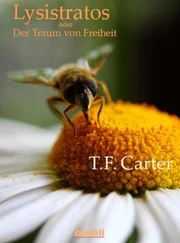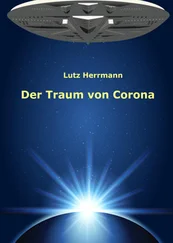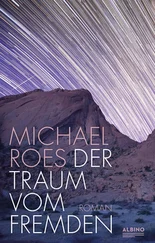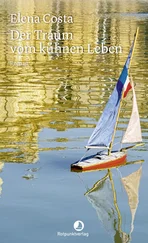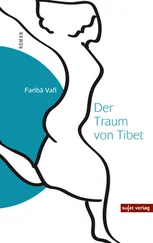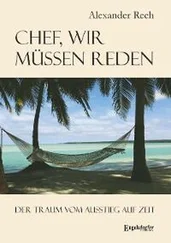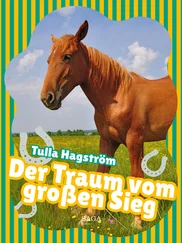Plakat von Otto Morach im Auftrag des Verkehrsvereins Davos, um 1926.
Unabhängig davon, ob die Tuberkulosebehandlung im Höhenklima oder wie in Deutschland oder England in einem Sanatorium im Flachland stattfand: Zentrales Element der Therapie war, dass sich die Patientinnen und Patienten möglichst lang an der frischen Luft aufhielten. Neben der Luft war ab 1900 für manche Mediziner auch das Licht entscheidend für die Therapie. Ärzte beschrieben die Tuberkulose als «Krankheit der Dunkelheit», die durch lichtarme, rauchbelastete Wohn- und Arbeitsverhältnisse in den Städten gefördert wurde. Ausserhalb der Industriezentren gelegene Lungenheilanstalten versprachen dank frischer Luft und Sonnenlicht Heilung. Aufgrund der Tuberkulosetherapie wurden Licht, Luft und Sonne zum Inbegriff von Gesundheit, was auch auf Kunst und Architektur ausstrahlte. Es entstanden spezielle Heilanstalten, Sanatorien mit geschützten Balkonen und Liegehallen, welche den Patienten den «Genuss» von möglichst viel Luft und Licht ermöglichten. Auch im Wohnhausbau der Moderne hielt dieses Ideal mit dem Einbezug von Balkonen, Terrassen oder grossen Fenstern Einzug. 15Und noch heute ist die «gute Bergluft» ein wichtiges Element für die Vermarktung der Alpenregion. 16Kürzlich hat die Regierung des Kantons Graubünden den «Gesundheitstourismus» zu einem Schwerpunkt ihrer Tätigkeit erhoben und dabei auf die Mitte des 19. Jahrhunderts erkannte «gesundheitsfördernde Wirkung des Hochgebirgsklimas» verwiesen. 17Und selbst in der neuesten Fachliteratur über Davos wird die Meinung vertreten, dass das Höhenklima die Tuberkulose heile. 18
Einige elegante Bauten in Davos oder Leysin erinnern noch an die Sanatoriumsbehandlung, die während Jahrzehnten als Standardtherapie bei Lungentuberkulose galt. Zahllose Patienten suchten Heilung in solchen Heilstätten, nicht selten vergeblich. In der Schweiz war von 1891 bis 1900 mehr als jeder zehnte Todesfall auf Lungentuberkulose zurückzuführen. 19Wirksame Medikamente gegen die «weisse Pest» fehlten bis Ende der 1940er-Jahre, als gegen das Tuberkulosebakterium wirkende Substanzen erhältlich wurden. Die Hoffnung, die Tuberkulose mit den Antibiotika besiegen zu können, erfüllte sich trotz eines Rückgangs der Krankheit in den folgenden Dekaden nicht. Heute stellt die Tuberkulose nach wie vor eine äusserst gefährliche Infektionskrankheit dar: Zwei Milliarden Menschen sind Träger des Tuberkulosebakteriums, jährlich sterben rund eineinhalb Millionen Menschen an dieser Krankheit. Regelmässig berichten Medien über die «Rückkehr der Tuberkulose» nach Westeuropa und in die USA. Resistente Keime erschweren die medikamentöse Therapie, Patienten mit schweren Resistenzen können manchmal nicht mehr behandelt werden. Experten fordern deshalb gar die Wiedereinrichtung von Sanatorien, um Patienten mit resistenten Bakterien palliativ betreuen zu können und um die Bevölkerung vor Ansteckung zu schützen. 20
Fragestellung, Untersuchungsgegenstand und theoretischer Ansatz
Wie kam es nun dazu, dass es unter den Gutbetuchten in ganz Europa «Sitte» war, zur Tuberkulosebehandlung nach Davos oder Arosa zu fahren, wie es Katia Mann beschrieben hat? Dieser Frage gehe ich in meiner Arbeit nach. Mich interessiert, wie sich die Theorie, dass das Höhenklima die Lungentuberkulose heilen könne, nach 1850 in Medizin und Gesellschaft etablieren und bis 1950 bei der Behandlung der Lungentuberkulose eine derart wichtige Rolle spielen konnte. Im Einzelnen ergeben sich daraus folgende Fragen: Wann und in welcher Form tauchte die Theorie des heilenden Höhenklimas in der medizinischen Diskussion auf? Mit welchen Argumenten konnte sie sich in der Medizin etablieren und behaupten? Wie setzten sich ihre ärztlichen Befürworter – die für die Diskussion zentralen Akteure – mit konkurrierenden Theorien auseinander, und wie reagierten sie auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse? Und schliesslich: Wie wirkte sich die Theorie auf die Praxis der Ärzte, auf die Situation von Patientinnen und Patienten und auf die Entwicklung von Höhenkurorten aus? Meine Arbeit geht somit primär wissenschaftsgeschichtlichen Fragen nach und untersucht die Entstehung und Zirkulation von Wissen, daneben kommen auch medizin- und sozialgeschichtliche Aspekte zur Sprache. 21Von Interesse sind auch biografische Bezüge von Ärzten und Wissenschaftlern, die über die Höhentherapie publizierten und diese verteidigten, da ihre persönliche Lebenssituation oftmals in enger Beziehung mit ihrem wissenschaftlichen oder therapeutischen Wirken stand. Untersucht wird in der Arbeit die Zeit zwischen 1850 und 1950. Ab 1850 setzen Ärzte die Idee um, dass hoch gelegene Orte die Lungenschwindsucht heilen könnten. Um 1950 verlor die Höhenbehandlung in Sanatorien an Bedeutung, unter anderem weil nun Antibiotika zur Verfügung standen, die eine Behandlung in Sanatorien nicht mehr zwingend notwendig erscheinen liessen. Davos war gemessen an den Gästezahlen der bedeutendste Kurort, in dem zahlreiche Interessenvertreter der Höhenkur tätig waren. 22Zudem entstanden wissenschaftliche Studien, welche die «Heilkraft» des Höhenklimas bei Lungentuberkulose belegen sollten, häufig in Davos, weshalb Davos als Pionierort und bekanntester Höhenkurort in dieser Arbeit häufig vorkommt. Es geht mir jedoch nicht um die Lokalgeschichte dieses Ortes, vielmehr sind auch andere hoch gelegene Orte in der Schweiz Schauplatz des Buches. Insgesamt waren es nämlich schweizerische Ortschaften, denen es gelang, eine heilsame Höhenklimawirkung geltend zu machen, obwohl der Anteil der Schweiz an den Alpen flächenmässig deutlich kleiner ist als derjenige von Österreich oder Italien. Dennoch kommen in meiner Studie auch Orte und Mediziner aus anderen Ländern vor: So wurde die Höhentherapie konzeptionell und methodisch um 1850 von einem Arzt im damals preussischen Schlesien entwickelt, und auch in anderen Ländern setzten Mediziner auf die therapeutische Wirkung von erhöhten Gegenden. Zudem hatte die Höhenkur in der Schweiz internationale Ausstrahlung, weshalb auch Ärzte aus anderen Ländern ihre Patienten zur Lungenkur ins Hochgebirge sandten.
In theoretischer Hinsicht nehme ich eine konstruktivistische Perspektive ein. Ich gehe davon aus, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Medizin nicht einfach die Entdeckung einer natürlichen Ordnung darstellen, welche unabhängig vom menschlichen Handeln existiert. 23Vielmehr können die Beziehungen zwischen Menschen und ihre sozialen Interessen zur Erklärung beitragen, wie es zu bestimmten wissenschaftlichen Aussagen kommt. 24So wurde die Höhenkur auch deshalb wichtig, weil Mediziner geschickt ihre Interessen vertraten und Verfechter der Höhenbehandlung unablässig Artikel und Studien über heilsame Faktoren des Höhenklimas publizierten. Ein Artikel ist gemäss dem Wissenschaftssoziologen Bruno Latour «eine kleine Maschine, um Interessen, Überzeugungen zu verschieben und in einer Weise zu orientieren, dass der Leser gleichsam unweigerlich in eine bestimmte Richtung gelenkt wird». 25
Die Erforschung von Interessen, welche Theorie und Praxis der Medizin formen, wird als wichtiges Thema der Geschichtswissenschaft angesehen. 26Wissenschaftshistoriker stellen sie aber auch infrage, etwa weil sich der kausale Zusammenhang zwischen Interessen der Akteure und medizinischem Inhalt nicht belegen lasse. 27Interessen der damaligen Akteure geltend zu machen, nimmt zudem in Anspruch, deren Intentionen erkennen zu können. 28Ich halte es jedoch für angemessen, in dieser Arbeit über die Höhenkur eine Interessentheorie zu verwenden – weil Interessen wie das Streben nach Macht, Geld und Autorität in den Quellen fassbar werden: Viele der Ärzte, welche zur Höhenbehandlung der Tuberkulose anmahnten, zogen als Kurärzte oder Mitbesitzer von Kurhäusern und Sanatorien einen direkten finanziellen Nutzen daraus – der Medizinhistoriker Vincent Barras spricht vom Typus des «entrepreneur médical». 29Dies verweist auf die Gesundheitsökonomie mit ihrer Theorie der «angebotsinduzierten Nachfrage»: Der Arzt ist Anbieter von Leistungen, zugleich berät er die Patienten beim Entscheid, welche Leistungen sie nachfragen sollen. 30Die Ärzte haben so die Möglichkeit, die Nachfrage nach Therapien zu steuern. Ärzte können ihr Einkommen erhöhen, wenn sie mehr Patienten mehr medizinische Leistungen nachfragen lassen. Allerdings wäre es eine unzutreffende Verkürzung, den Einsatz der Ärzte für das Höhenklima auf finanzielles Eigeninteresse zu reduzieren. Nicht alle Ärzte, welche die Höhenbehandlung befürworteten, profitierten persönlich davon. Zudem waren wohl viele Ärzte in Übereinstimmung mit ihrer Berufsethik davon überzeugt, zum Wohl ihrer Patienten zu handeln. Die Ärzteschaft war in den ersten Jahren des Untersuchungszeitraums noch immer bestrebt, sich in der Gesellschaft als Heilkundige zu etablieren. Der «Aufstieg» der Ärzte konnte sich nur vollziehen, wenn sie Therapieangebote bereithielten, die Heilung versprachen. 31
Читать дальше