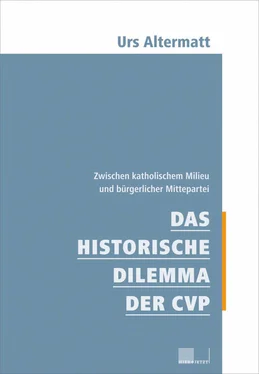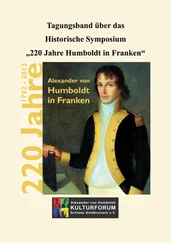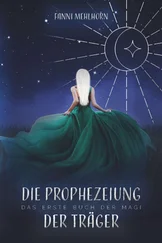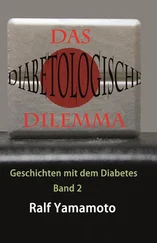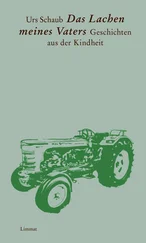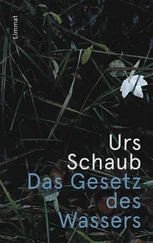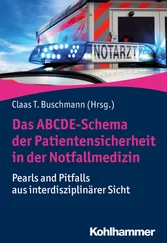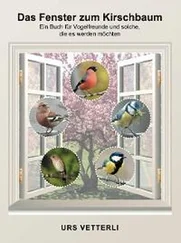Über das Gebiet des früheren Sonderbundes kam die katholisch-konservative Rückeroberung nicht hinaus. Kein reformierter Kanton wechselte das Lager. Das konservative Regime in Bern von 1850 bis 1854 blieb Episode. Auf die Dauer gesehen bedeutete der Ausfall Berns den Verlust der protestantischen Variante im politischen Konservativismus.
Die starre Ausschliesslichkeitspolitik der freisinnigen Gründungsväter milderte sich erst, als sich der Bundesstaat über die kritischen Anfangsjahre hinweg konsolidiert hatte. Der Aufbau des modernen Industriestaats mit Eisenbahnen und Fabriken zwang die ehemaligen Bürgerkriegsgegner zur Zusammenarbeit auf politischer und wirtschaftlicher Ebene.
Die weltanschaulichen Konflikte traten hinter die praktischen Fragen des politischen Alltags zurück. Noch waren die Katholisch-Konservativen strikt von den eidgenössischen Regierungspfründen ausgeschlossen, doch die Alltagspolitik begann sie in den bestehenden Bundesstaat zu integrieren. Sie verstanden sich mehr und mehr als loyale Opposition und wollten auch als solche vom Freisinn behandelt werden. Die Wunden des Bürgerkriegs schienen in der zweiten Hälfte der 1860er-Jahre allmählich zu vernarben. Da brachen die alten Gegensätze Anfang der 1870er-Jahre mit der unheilvollen Verquickung von Bundesrevision und Kulturkampf neu auf.
1874–1891: Fundamentalopposition gegen das freisinnige «System»
Das Jahr 1874 bildete mit der Totalrevision der Bundesverfassung eine wichtige Zäsur in der eidgenössischen Politik. Unter Ausnützung der Kulturkampfstimmung gelang es der freisinnigen Regierungspartei, die Katholisch-Konservativen zu isolieren und damit das Revisionsprojekt im zweiten Anlauf durchzubringen.
In der Rückschau gesehen erwies sich der kulturkämpferische Antikatholizismus des Freisinns als Bumerang. Der Kampf des antiklerikalen Freisinns mobilisierte die Massen des kirchentreuen katholischen Volksteils. Wie nie zuvor wurden die katholische Kirche und ihre Vereine zu einem Rückzugsgebiet und Aufmarschfeld gegen den freisinnigen Zeitgeist und seine Partei. Der politische Konservativismus nahm nun endgültig konfessionelle Züge an. Die konservativen Katholiken zogen sich in eine katholische Sondergesellschaft zurück, in der sie sich heimisch einrichteten und zum Kampf gegen den Radikalismus antraten. Um Zeitungen, Vereine und Parteien begannen sie die katholisch-konservative Volksbewegung auf breiter Front aufzubauen. Im Jahr 1871 begannen in Luzern das «Vaterland» und in Freiburg «La Liberté» als Zentralorgane der katholischen Schweiz zu erscheinen.
Der Kulturkampf hatte zur Folge, dass sich der politische Katholizismus konsolidieren konnte. Er vermochte seine Positionen in den Stammlandkantonen zu soliden Bastionen auszubauen und in den Kantonen ausserhalb des alten Sonderbundes Fuss zu fassen. So erzwangen sich die Katholisch-Konservativen zunächst in St. Gallen und im Tessin den Eintritt in die Kantonsregierung. In den 1880er- und 90er-Jahren folgten die Kantone Aargau, Glarus, Solothurn, Graubünden und Thurgau nach.
Ein weiterer Aspekt kam hinzu. Hatte die katholisch-konservative Opposition in den Eidgenössischen Räten von 1848 bis 1874 eine unbedeutende und von der freisinnigen Staatspartei mehr oder weniger ignorierte Minderheit dargestellt, so wuchs sie nach 1874 dank des direktdemokratischen Referendums zu einem ernstzunehmenden Faktor in der eidgenössischen Politik heran. In zahlreichen Referendumsabstimmungen machte sie gegen das freisinnige Bundesregime erfolgreich Opposition und kompensierte damit ihre Aussenseiterrolle in Parlament und Regierung.
Unter der Fahne des Föderalismus scharte sie von Abstimmung zu Abstimmung eine wechselnde Koalition von unzufriedenen Kampfgenossen zusammen, deren Loyalität zum freisinnigen Bundesstaat bröckelte. Im Jahr 1884 schickte die konservative Protestbewegung ein ganzes Paket von vier verhältnismässig unbedeutenden Gesetzesvorlagen unter dem zügigen Slogan «vierhöckriges Kamel» bachab. «Weniger Staat» lautete die konservative Parole.
Die konservativen Referendumsstürme, die zwischen 1875 und 1884 obstruktionistische Züge angenommen hatten, brachten die freisinnige Regierung ins Wanken, die die bisherige personelle Ausschliesslichkeitspolitik aufgeben musste. 1873/74 präsidierte erstmals ein Katholisch-Konservativer den Ständerat, 1879 nahm zum ersten Mal ein Vertreter katholisch-konservativer Couleur Einsitz ins Bundesgericht. Im Jahr 1887 stieg ein katholisch-konservativer Politiker zum Präsidenten des Nationalrats und damit der Vereinigten Bundesversammlung auf.
Damit begann der lange Marsch der katholisch-konservativen Opposition zur Beteiligung an der Macht im Bundesstaat. Mitte der 1880er-Jahre verlor die Opposition ihren fundamentalisitischen Charakter. Im Programm von 1883 stellte sich die Fraktion auf den Boden der bestehenden Bundesordnung und signalisierte klar ihre Bereitschaft zu konstruktiver Mitarbeit. Die Mehrheit der Katholisch-Konservativen gab ihre Fundamentalopposition gegen den bestehenden Staat auf.
Damit war ein wichtiger Wendepunkt erreicht. Zwischen der freisinnigen Regierungspartei und der katholisch-konservativen Opposition begann sich auf der sachpolitischen Ebene ein Basiskonsens einzuspielen. Dieser Konsens entzog der radikalen Ausschliesslichkeitspolitik ihre Daseinsberechtigung. Der historische Kompromiss stand vor der Tür.
Doch wie im Drehbuch eines Dramas spitzte sich der Gegensatz vor der endgültigen Aussöhnung nochmals explosiv zu. Im September 1890 stürzte ein radikaler Putsch die konservative Regierung im Tessin. Damals wurde zum letzten Mal in der Geschichte des Bundesstaats ein amtierender Regierungsrat das Opfer eines politischen Attentats. Eidgenössische Truppen marschierten im Südkanton ein, stellten Ruhe und Ordnung her und liessen über eine Volksabstimmung den Regierungsproporz in der Verfassung verankern. Damit kehrte im Tessin nach jahrzehntelangen blutigen Parteikämpfen endlich Ruhe ein.
Man spürte es allenthalben: Die langsame Agonie der freisinnigen Hegemonie hatte eingesetzt. In einem letzten trotzigen Aufbäumen verwehrte die regierende Staatspartei im Jahr 1890 aus kulturkämpferischen Ressentiments heraus den Katholisch-Konservativen nochmals den Eintritt in die Landesregierung. Hartnäckig verteidigte sie ihre Monopolstellung. Der freisinnige Affront löste bei der oppositionellen Minderheit Verbitterung aus. Das deutschschweizerische Zentralorgan «Vaterland» schrieb: «Alle Minoritäten werden vergewaltigt.» 3
1891–1943: Juniorpartner in der «Bürgerblock»-Regierung
Anfang der 1890er-Jahre wurde die Krise des freisinnigen Regierungssystems offenkundig. Wenn man verhindern wollte, dass das politische System der Schweiz völlig unregierbar wurde, musste die katholisch-konservative Opposition über kurz oder lang in die Landesregierung integriert werden.
1891 war es endlich so weit. Den Anstoss gab eine eidgenössische Staatskrise kleineren Ausmasses. Als eine Vorlage für die Verstaatlichung von Eisenbahnen vom Schweizer Volk verworfen wurde, trat der Vorsteher des Post- und Eisenbahndepartementes 1891 gegen alle bisherigen Bräuche zurück. Damit offenbarte sich die Krise des bisherigen freisinnigen Ausschliesslichkeitsregimes vor aller Öffentlichkeit. Der Freisinn fing die Regierungskrise dadurch auf, dass er der katholisch-konservativen Opposition einen Platz in der Landesregierung anbot.
Mit dem Einzug des Luzerners Josef Zemp in den Bundesrat erlangten die Katholisch-Konservativen 1891 den Status einer regimentsfähigen Regierungspartei. Allerdings verstanden sie sich gleichzeitig weiterhin fallweise auch als Oppositionspartei, ein Begriff, der für sie «Kampf dem System» bedeutete, denn mit einem einzigen Bundesrat waren sie in der Landesregierung weit untervertreten. Als Volkspartei sahen sie sich als Gegensatz zur «Beamten- und Herrenpartei», lies: zur «classe politique».
Читать дальше