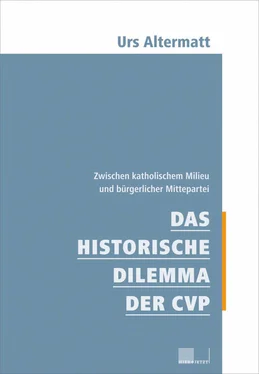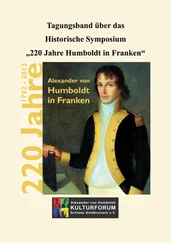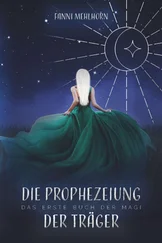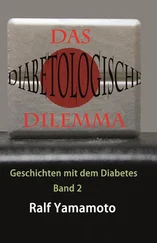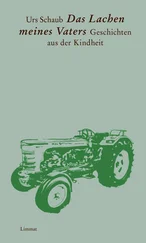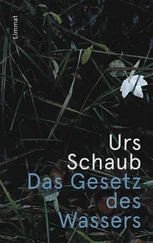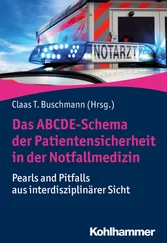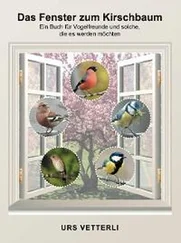Der Aufstieg des Diasporakatholizismus kann in drei Phasen eingeteilt werden. In den paritätischen Kantonen Graubünden und St. Gallen kamen die Katholisch-Konservativen schon vor 1874 in die Regierung. In diesen Kantonen mit starken katholisch-konservativen Minderheiten entwickelte sich bereits im 19. Jahrhundert eine Art freiwilliger Proporz. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts wurden die Aargauer, Solothurner, Thurgauer und Glarner ebenfalls regimentsfähig, 1885 im Aargau, 1887 in Solothurn, 1895 im Thurgau. Diese Erfolge verliefen parallel zum erstmaligen Einsitz im Bundesrat im Jahr 1891.
Bereits Ende der 1860er-Jahre war es im politisch turbulenten Kanton Tessin den Konservativen gelungen, während einer Periode die Mehrheit zu erobern. Nach den Tessiner Unruhen, die dem katholisch-konservativen Regierungsrat Luigi Rossi 1890 das Leben gekostet hatten, führte der vom Bundesstaat erzwungene Proporz 1892 zu einer permanenten Regierungsbeteiligung im Südkanton.
Um die Zeit des Ersten Weltkriegs setzte die zweite Phase ein. Die Einführung des Proporzwahlrechts auf eidgenössischer Ebene ermöglichte es den christlichdemokratischen Diasporakatholiken in den städtischen Zentren der reformierten Schweiz, Vertreter in den Nationalrat zu entsenden. 1917 kam der bekannte Basler Advokat Ernst Feigenwinter und 1919 der Redaktor an den «Neuen Zürcher Nachrichten» Georg Baumberger in den Nationalrat. 1928 entsandten auch die Baselbieter einen Katholisch-Konservativen in die Volkskammer. Schwieriger war es für die Christlichdemokraten in diesen Kantonen, einen Vertreter in die Kantonsregierung zu entsenden. In Basel und Genf gelang dies für gewisse Perioden am Ende des Ersten Weltkriegs, in Baselland 1936.
Erst 1963 – und das war die dritte Phase – eroberten auch die Zürcher Christlichsozialen einen Regierungssitz, den sie allerdings 1975 wieder abgeben mussten, bis sie ihn 1993 zurückgewannen und 2011 wieder verloren. Bisher waren die Christlichdemokraten in den Kantonen Bern, Schaffhausen, Waadt, Neuenburg und Appenzell Ausserrhoden nicht in den Kantonsregierungen vertreten.
Die Nichtberücksichtigung der christlichdemokratischen Nordjurassier in der Berner Regierung war eine der Antriebsfedern für die Gründung des Kantons Jura. Ohne dass die Medien dies speziell beachten, nimmt die CVP im Kanton Jura daher eine starke Stellung ein, was mit ihren Verdiensten bei der Kantonsgründung 1978 zu erklären ist.
Heimliche Macht der Stammlande über den Ständerat
Wenn ich die Entwicklung seit 1848 überblicke, komme ich zu folgenden Schlussfolgerungen:
1. Die total revidierte Bundesverfassung von 1874 bildete für die Christlichdemokraten eine Zäsur. Diese hatte zur Folge, dass in den Volksabstimmungen jede Stimme zählte. Damit verloren die auf sich bezogenen kantonalen Bastionen der Stammlande in der Partei ihre unbestrittene Vormachtstellung. Die Stimme des katholisch-konservativen Solothurners zählte ebenso viel wie diejenige des Innerschweizers und Wallisers. Erst die Referendumsstärke gab den Katholisch-Konservativen das notwendige Gewicht, um auf Bundesebene von der Oppositionsbank in die Regierung zu wechseln.
2. Nach der Einführung des Proporzwahlrechts im Ersten Weltkrieg beschleunigte sich die innerparteiliche Gewichtsverlagerung von den Stammlanden in die Ausser-Schweiz. 1919 entsandten die Katholisch-Konservativen der Stammlande 20 Nationalräte in die Volkskammer, die übrigen Kantone bereits 21. Die St. Galler Konservativen allein zählten 1919 mehr Parteiwähler als die Urschweizer Kantone zusammen.
3. In den Spitzenämtern der Partei wiederspiegelte sich diese Machtverschiebung äusserst langsam. Die Stammlande gaben ihre Macht nur schrittweise ab. Geht man die Liste der Fraktionspräsidenten seit 1848 durch, standen bis 1900 nur Politiker aus den Stammlanden an der Spitze.
Von 1902 bis 1911 führten erstmals zwei Politiker von Regionen ausserhalb der Stammlande die Fraktion, der Bündner Caspar Decurtins (1902–1905) und der St. Galler Othmar Staub (1905–1911). Später folgten der Thurgauer Alfons von Streng (1914–1919), der Aargauer Emil Nietlispach (1940–1942), der St. Galler Thomas Holenstein (1942–1954), der Bündner Giusep Condrau (1954–1960) und der St. Galler Kurt Furgler (1963–1971). Im Unterschied dazu gelangten in der Landespartei regelmässig Politiker von ausserhalb der Stammlande zum Präsidentenamt. Zu erwähnen ist als Erster 1932 der St. Galler Eduard Guntli. Es folgten der Aargauer Emil Nietlispach (1935–1940), der Aargauer Max Rohr (1950–1955), der Italienischbündner Ettore Tenchio (1960–1968), die St. Gallerin Eva Segmüller (1987–1992), der Thurgauer Philipp Stähelin (2001–2004) und die Aargauerin Doris Leuthard (2004–2006). 9
4. Wie die Staaten in den USA entsenden alle Kantone gleich viele, nämlich zwei Ständräte, in die Kleine Kammer. Dieser föderalistische Grundsatz privilegiert die kleinen Kantone. Im Ständerat lebt auf diese Weise das Konzept der Stammlande in veränderter Weise fort, weshalb die CVP mit ihren 13 Sitzen auch noch nach 2011 eine bestimmende Rolle im interfraktionellen Kräfteparallelogramm des Ständerates einnimmt.
5. Bis 1950 besass die katholische Weltanschauung genügend Integrationskraft, um die Gegensätze zwischen den agrarisch-gewerblichen Stammlanden und den sozialreformerischen Christlichdemokraten in den urbanen Mittelland-Agglomerationen zu überwinden. Mit Hilfe von innerparteilichen Entscheidungsmechanismen entwickelte sich ein Ausgleich zwischen den Konservativen und den Christlichsozialen. Mit dem Zusammenbruch des Milieukatholizismus seit den späten 60er-Jahren begann dieses Band zu zerreissen. Innerhalb der Partei verschärften sich die Konflikte.
Obwohl die Reformer von 1970 eine Homogenisierung der Landespartei anstrebten, wurden die innerparteilichen Konflikte seit den 80er-Jahren stärker. Wenn der Politgeograf Hermann im Vergleich mit der deutschen Schwesterpartei in der CVP einen vermittelnden «Rumpf» vermisst, ist ihm teilweise zuzustimmen. Wie indessen das Beispiel der CSU Bayerns zeigt, lassen sich die konservativen und christlichsozialen Flügel unter einem Dach vereinen, sofern ein gemeinsamer Nenner – im Fall Bayerns die regionale Identität – vorhanden ist. Welches Kohäsionsmittel nach dem Wegfall des K (= katholisch) in der CVP zur Verfügung steht, bleibt die Kardinalsfrage.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.