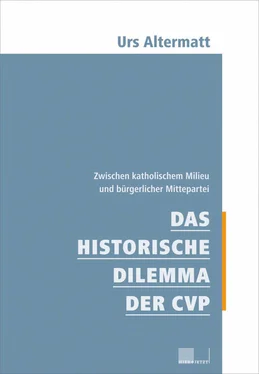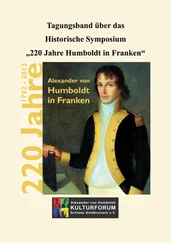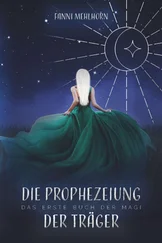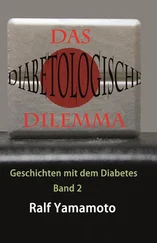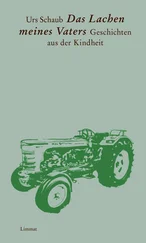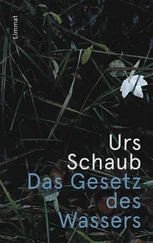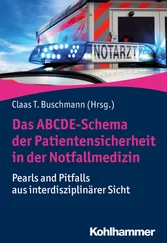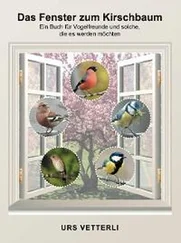Mitte der 1960er-Jahre erhielt die ausserordentliche Stabilität, die das Parteiensystem bisher ausgezeichnet hatte, erste Risse, ohne dass diese vorerst zu nachhaltigen Umstürzen führten. Die Einbrüche ins Parteiengefüge erfolgten aus drei politischen Richtungen. Zunächst gewann die «nonkonformistische» Opposition des vom Regierungskartell ausgeschlossenen liberal-sozialen Landesrings der Unabhängigen an Stimmen, der in den Nationalratswahlen von 1967 mit 9,1 Prozent seinen Höhepunkt erreichte. In den späten 60er-Jahren bildeten sich als Reaktion auf die zunehmende Fremdenangst im Zusammenhang mit den steigenden Ausländerzahlen (1970: 15,9 Prozent) rechtspopulistische Anti-«Überfremdungs»-Parteien, die 1971 einen Überraschungserfolg erzielten, mit 4,3 Prozent die Republikaner und mit 3,2 Prozent die Nationale Aktion. In der zweiten Hälfte der 80er-Jahre stiessen links-alternative und grüne Kleinparteien dazu, wobei die Grünen den nachhaltigsten Erfolg erzielten. 11
Diese Oppositions- und Protestbewegungen von rechts und von links führten zum Schrumpfen der vier Traditionsparteien. Der Rückgang der Christlichdemokraten bewegte sich bis Ende der 80er-Jahre parallel zu den Verlusten der vier Regierungsparteien. Wer der CVP damals einen Niedergang voraussagte, wurde nicht ernst genommen.
Neue Parteienlandschaft seit den neunziger Jahren
Seit den 1990er-Jahren veränderte sich die Parteienlandschaft fundamental. 12Ausgangspunkt war der aussergewöhnliche Aufstieg der SVP, die sich unter der Führung des Zürcher Nationalrats Christoph Blocher zu einer national-konservativen Partei wandelte. Die SVP vermochte ihren jahrzehntelangen Stimmenanteil von rund 11 Prozent von 1991 bis zu den Nationalratswahlen 2007 auf 28,9 Prozent zu steigern. Erst 2011 kam dieser Aufstieg – vorläufig? – zum Stillstand und führte zu leichten Verlusten. Dies machte die SVP innerhalb weniger Jahre zur grössten Partei der Schweiz. Als Folge dieser Entwicklung polarisierte sich die Parteienlandschaft. Es entstand in den Worten des Politologen Claude Longchamp ein «tripolares» Parteigefüge.
In einer gegenläufigen Bewegung zur SVP verloren zwischen 1995 und 2011 vor allem die «bürgerlichen» Traditionsparteien FDP und CVP dramatisch Wähler. Bei den Wahlen 2003 sank die CVP auf das historische Tief von 14,4 Prozent. Ein solches verzeichnete auch die FDP, die auf 17,3 Prozent einbrach. 2007 vermochte sich die CVP bei 14,5 Prozent zu stabilisieren, während die FDP mit 15,8 Prozent erneut verlor. 2011 war es umgekehrt: Die CVP büsste erneut ein und landete bei 12,3 Prozent.
Die Analyse des Bundesamts für Statistik unter der Leitung von Werner Seitz zeigt auf, dass CVP und FDP von 1979 bis 2011 um die 9 Prozent einbüssten. 13Aus den Wahlen von 2011 gingen die Parteien der sogenannten «neuen Mitte» als relative Wahlsieger hervor: Die Grünliberalen (GLP) steigerten sich auf 5,4 Prozent, und die 2008 aus der Abspaltung von der SVP hervorgegangene «Bürgerlich-Demokratische Partei» (BDP) erreichte auf einen Schlag 5,4 Prozent. 2007 und 2011 musste auch die SP ein Wahlresultat unter der 20-Prozent-Marke verzeichnen. In der längeren Perspektive befanden sich die Grünen im Aufwind, die 2007 auf 9,6 Prozente zulegten, dieses Resultat jedoch 2011 mit 8,4 Prozent nicht zu halten vermochten. In den Wahlen von 2011 kam – wie Claude Longchamp und sein Team festhalten – der Polarisierungszyklus, der mit der EWR-Abstimmung 1992 begann, zum Ende. 14Das Drei-Pole-Parteiensystem mit flexiblen Koalitionen blieb bestehen.
Einbrüche
Wie Werner Seitz und Madeleine Schneider in ihrer Wahlanalyse feststellen, veränderte sich die regionale Verankerung der CVP nicht wesentlich. 15Noch immer tragen die Kantone Luzern, St. Gallen und Wallis am meisten zur nationalen Stärke bei. Die stärksten Kantonalparteien stellten 2011 das Wallis (39,9%), der Jura (33,2%) und Luzern (27,1%). Allerdings verloren seit 1979 Luzern, Schwyz und St. Gallen über 20 Prozent der Wähler. In welchen Regionen und Kantonen erfolgten die nachhaltigsten Einbrüche der Christlichdemokraten? Gibt es in der zeitlichen Abfolge besondere Entwicklungen?
Die Stagnation der CVP manifestierte sich – erstens – in den städtischen Ballungszentren ausserhalb der traditionellen Hochburgen. Seit den 1970er- und 80er-Jahren wechselten in den städtischen Agglomerationen der Kantone Zürich, Basel und Bern zahlreiche Sozialaufsteiger katholischer Konfession, die als schweizerische «Secondos» nicht mehr von den moralischen und gesellschaftlichen Bindekräften des katholischen Milieus ihrer familiären Herkunftskantone gehemmt wurden, zum bürgerlichen Freisinn und zur Linken über, die nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil wählbar geworden waren. Als Resultat des veränderten Wahlverhaltens bisheriger Stammwähler in der klassischen Diaspora wurde das bevölkerungsreiche Mittelland von Zürich bis Lausanne für die CVP zum wahlpolitischen Ödland. In den grossen, von ihrer Geschichte her protestantisch geprägten Mittellandkantonen Zürich, Bern und Waadt, wo die Katholikenpartei aus historischen Gründen nie eine starke Position besessen hatte, schrumpfte ihr ohnehin kleiner Anteil zusammen. Von den insgesamt 78 Sitzen dieser drei Kantone im Nationalrat hielt sie 2011 nur noch 3; 1963 waren es von 84 immerhin noch deren 8 gewesen. Selbst in Zürich, wo die Christlichsozialen in einem langsamen, aber stetigen Aufstieg in die Regierung gelangt waren, liefen jüngere Wähler der Partei davon. Für die Generationenthese stellt Zürich das beste Beispiel dar, da die Zwingli-Stadt im Jahr 2009 mit 112 000 Katholiken den grössten Anteil aller Schweizer Städte aufweist.
Eine zweite Beobachtung: In den 1980er-Jahren erfasste der Erosionsprozess auch in unterschiedlichem Ausmass die alten Kulturkampfkantone St. Gallen, Aargau, Thurgau, Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Landschaft und Genf. Der neue Kanton Jura blieb eine Ausnahme, da sich dort die Christlichdemokraten als aktive Gründungspartei des Kantons profiliert hatten. Die jurassische CVP erhielt 1979 37,7 Prozent und konnte diesen Stand über die Jahrzehnte hinweg halten (2011: 33,2%). Damit begannen die Christlichdemokraten in jenen Gebieten zu verlieren, in denen sie seit über hundert Jahren als Partei des politischen Katholizismus fest verankert waren. Aus historischer Perspektive wogen die Sitzverluste in diesen Kantonen schwerer als diejenigen in den früheren Diasporakantonen Zürich, Waadt und Bern, denn mehr als anderswo verdeutlichten sie den Zusammenbruch parteipolitischer Loyalitäten.
Als Beispiele verweise ich auf die Kantone St. Gallen, Aargau und Solothurn. In St. Gallen stellte die CVP 1963 6 von 13 Nationalratssitzen, im Aargau 3 von 13 und in Solothurn 2 von 7. 1983 sah das Bild folgendermassen aus: St. Gallen 5 von 12, Aargau 4 von 14 und Solothurn 2 von 7. Der eigentliche Einbruch in diesen Kantonen erfolgte mit unterschiedlichen Zeitrhythmen und lokalen Besonderheiten im letzten Jahrzehnt des 20. und im ersten des 21. Jahrhunderts. 2003 eroberten die Christlichdemokraten im Kanton St. Gallen nur noch 3 von 12, im Aargau 2 von 15 und im Kanton Solothurn 1 von 7 Nationalratssitzen. 2011 sah die Statistik wie folgt aus: St. Gallen 3 von 12, Aargau nur noch 1 von 15 und Solothurn dank geschickten Listenverbindungen 2 von 7 Sitzen. Alles in allem büssten die Christlichdemokraten seit 1963 fast 50 Prozent ihrer Nationalratsmandate in den alten Kulturkampfkantonen der Schweiz ein. Am besten hielten sich mandatsmässig die Christlichdemokraten Solothurns.
Und schliesslich der dritte Punkt: Die katholischen Stammlandkantone Schwyz, Luzern, Zug, Obwalden, Nidwalden, Uri, Freiburg und Wallis waren für die CVP seit dem 19. Jahrhundert als Reaktion auf die bittere Niederlage im Bürgerkrieg von 1847 Hochburgen, ja Bollwerke der Partei. Seit den Nationalratswahlen von 1999 verlor die Partei auch in diesen Kantonen in dramatischer Weise Wählerstimmen. 2011 stellte die CVP nur noch 10 von total 34 Nationalräten in den Stammlandkantonen.
Читать дальше