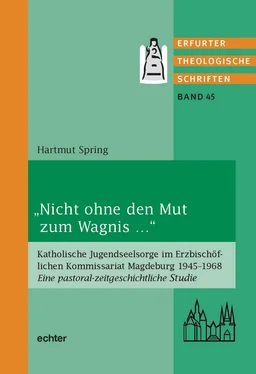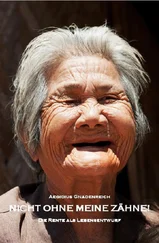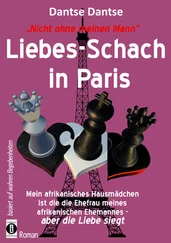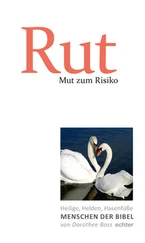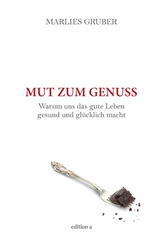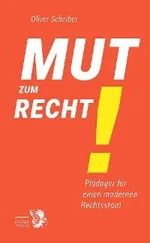4.1 Handlungsspielräume für die katholische Kirche im Kommissariat Magdeburg
Erschwerend zu den allgemeinen Schwierigkeiten, die für den gesamten Bereich der katholischen Kirche in der SBZ galten, ergab sich für das Kommissariat Magdeburg nach dem Krieg eine Situation wie auch für die Bereiche von Erfurt, Görlitz und Schwerin: Man war durch die Kriegsfolgen von seinem Bistum politisch aber nicht kirchenrechtlich getrennt. 114Mit dem Abzug der Amerikaner und der Besetzung des Gebietes durch die sowjetische Armee wurde das Gebiet des östlichen Paderborner Kirchensprengels, das spätere Kommissariat Magdeburg, vom Erzbistum politisch abgeschnitten. Infolgedessen wurde der Austausch zwischen Magdeburg und Paderborn stark beeinträchtigt. Daneben gab es aber auch noch die gravierenden Einschnitte durch die zerstörte Infrastruktur innerhalb des Kommissariates Magdeburg. Wegen der gesprengten Elbebrücken gab es nur eingeschränkte Verkehrsverbindungen zwischen den Dekanaten links und rechts der Elbe. Dadurch war gerade der Ostteil des Kommissariates durch die Kriegsfolgen für längere Zeit in doppelter Weise in der religiösen Betreuung beeinträchtigt. 115
Solange sich noch keine sozialistische Zentralregierung im Bereich der SBZ gebildet hatte und die Provinzen nicht von SED-Funktionären geleitet wurden, bestanden zunächst vielfältige Formen der gedeihlichen Zusammenarbeit zwischen staatlichen und kirchlichen Stellen, so auch in Sachsen-Anhalt. 116In den ersten Nachkriegsjahren, in denen die preußische Provinz Sachsen vom kirchenfreundlichen Ministerpräsidenten E. Hübener 117(LDP) und die Abteilung Kirchenwesen von H. Kunisch (CDU) geleitet wurden, galt es für die katholische Kirche noch viele Handlungsspielräume auszuschöpfen oder zu gestalten. 118E. Hübener und H. Kunisch setzten sich immer wieder dafür ein, dass das Recht der katholischen Kirche auf religiöse Erbauungs- und Unterweisungsarbeit an den Jugendlichen nicht angetastet und auch nicht auf den rein rituellen Bereich beschränkt wurde. 119Nach dem Rücktritt von E. Hübener im Oktober 1949 und der Flucht H. Kunischs vor der einsetzenden Säuberungswelle im Bereich der Landesregierung in den „Westen“ im Februar 1950 wurde das Klima zwischen den kirchlichen und staatlichen Stellen viel angespannter. Ließ die Verfassung der Provinz Sachsen-Anhalt den „Religionsgesellschaften“ noch weitgehend die Rechte aus der Zeit der Weimarer Republik, 120wurden diese Zugeständnisse gegenüber den Kirchen mit der Zentralstruktur der entstehenden DDR und der Auflösung der Länderstrukturen ab 1952 wieder aufgehoben. Die praktischen Konsequenzen, die sich aus dem politischen Handlungsspielraum für die Jugendseelsorge im Ostteil des Paderborner Erzbistums ergaben, waren von Anfang an stark einschränkend. Nur wenige Priester im Kommissariat gaben sich der Illusion hin, an die Situation von vor 1933 anknüpfen zu können. 121Nach den bereits frühzeitig gemachten Erfahrungen sahen sie ihre Tätigkeit vor allem auf die Katechese und die Sakramentenspendung, auf den Bereich der „ordentlichen Seelsorge“ eingeengt. 122Trotz aller Einschränkungen versuchte man auch im Kommissariat Magdeburg, die bescheidenen Möglichkeiten so lange als möglich auf dem Verhandlungswege zu verbessern. W. Weskamm 123und H. Aufderbeck waren die maßgeblichen Gesprächpartner für die staatlichen Stellen. Sie versuchten, die wenigen Handlungsspielräume für die Entfaltung der Jugendseelsorge in der Nachkriegszeit zu nutzen.
4.1.1 Vom schulischen zum außerschulischen Religionsunterricht
Das zeitweilige Ringen um die Wiederherstellung der Weimarer Verhältnisse im Bereich der SBZ wie auch im Kommissariat Magdeburg wurde vor allem auf der kirchenpolitischen Ebene ausgetragen. Dabei stand zunächst das eingeforderte Recht, katholischen Religionsunterricht an staatlichen Schulen durchführen zu können und katholische Schulen wieder zuzulassen im Zentrum des Bemühens der Ordinarien. 124Wie schon in der Zeit der Weimarer Republik wurde der schulische Religionsunterricht neben der Sakramentenkatechese als wesentlicher Ort der religiösen Sozialisation angesehen. Beide Elemente stellten die Grundlage der Jugenderziehung/Jugendseelsorge dar. Unter den Bedingungen der SBZ aber blieb das Bemühen um die Wiederzulassung der Bekenntnisschulen erfolglos bzw. wurde angesichts der politischen Verhältnisse schon bald zu einem Rückzugsgefecht, in dem es nur noch darum ging, den zugestandenen Religionsunterricht an den Schulen durchführen zu können. Nachdem keine gesetzliche Verankerung der Konfessionsschule ausgehandelt werden konnte, versuchte man nun, wenigstens die Durchführung des Religionsunterrichtes zu sichern.
Zunächst war die katholische Kirche vielerorts auf die Räumlichkeiten der evangelischen Kirche oder die der staatlichen Einrichtungen angewiesen. 125Anders wäre der Religionsunterricht rein technisch nicht durchführbar gewesen. Erst in den späten fünfziger Jahren war die Infrastruktur der katholischen Kirche derart ausgebaut, dass ausreichend kircheneigene Räume zur Verfügung standen, um den Religionsunterricht auch außerhalb der Schule durchführen zu können. 126Prinzipiell wurde die Möglichkeit zugesichert, den Religionsunterricht in der Schule durchzuführen, entsprechend der Verordnung über den Religionsunterricht vom 1. Oktober 1945 durch den Präsidenten der Provinz Sachsen 127und den Durchführungsbestimmungen zur Verordnung über die religiöse Unterweisung der schulpflichtigen Jugend 128sowie den zugehörigen späteren Ausführungsbestimmungen. Dennoch war die Durchführung des Religionsunterrichtes im öffentlichen Bereich schon bald gefährdet, da die Katecheten und Seelsorger bei der Ausübung des Religionsunterrichtes an den Schulen mit Behinderungen verschiedenster Art konfrontiert wurden. 129Um sich dagegen zur Wehr zu setzen, bediente sich die Kirche verschiedener Strategien. Sie versuchte, sich so lange wie möglich Schulräume als Orte kirchlicher Unterweisung zu sichern, 130weiterhin, wann immer möglich, evangelische Nachbarschaftshilfe in Anspruch zu nehmen. Daneben begann sie, so zügig es die Nachkriegsverhältnisse zuließen, kircheneigene Räumlichkeiten für die Durchführung des Religionsunterrichtes in den Gemeinden zu errichten. 131Die Frage des Religionsunterrichtes in der Schule betraf die Frage des kirchlichen Selbstverständnisses und dessen Unabdingbarkeit für die religiöse Sozialisation. 132
Es gibt genügend Zeugnisse dafür, die zeigen, dass sich die Kirchenleitungen, nicht nur per Lippenbekenntnis, um die Zulassung der Bekenntnisschule bemühten. 133Auch Erzbischof Jaeger in Paderborn schaltete sich mit offiziellen Anfragen an die SMAD in das Ringen um die Wiederherstellung der Weimarer Verhältnisse in der Schulfrage ein. 134Dennoch wurde schon bald klar, dass sich alle Hoffnungen nicht erfüllen würden. 135Dass man sich wie bereits in der Zeit des Nationalsozialismus auf die Pfarrseelsorge zurückziehen und nun erneut die Hoffnung auf die Bekenntnisschule aufgeben musste, löste bei nicht wenigen Seelsorgern Resignation aus. 136Die Kirchenleitungen versuchten dennoch die auch die Bevölkerung für eine Zulassung des Religionsunterrichtes zu mobilisieren. 137Von der nur langsam verblassenden Hoffnung auf eine reibungslose Durchführung des katholischen Religionsunterricht an den staatlichen Schulen genährt, absorbierte das politische Ringen um den Religionsunterricht in der Nachkriegszeit derart viele Kräfte, dass scheinbar für eine umfassende pastorale Standortbestimmung in der Kinder- und Jugendseelsorge nicht genug Energie zur Verfügung stand.
Das Ringen um den Religionsunterricht an der achtklassigen Volksschule war im engen Sinn kein Thema der Jugendseelsorge. Die Schulentlassung und die Aufnahme in die katholische Jugend verliefen meist parallel. Der weitaus größte Teil der Jugendlichen hatte die Schule mit 14 Jahren bereits verlassen. Erst mit der Einführung der zehnklassigen Polytechnischen Oberschule hätte es zu Berührungspunkten zwischen Jugendseelsorge und Religionsunterricht an der Schule kommen können, doch zu diesem späteren Zeitpunkt hatten die politischen Entwicklungen grundlegend andere Verhältnisse geschaffen. Der Religionsunterricht war zu diesem Zeitpunkt weitestgehend auf den Raum der Kirchengemeinde ausgewichen. Mit der Verbannung der Kirche aus der Schule ergab sich notgedrungen ein besonderes Schwergewicht für die Kinder- und Jugendseelsorge in der Pfarrei, woraus unter anderem die religiösen Kinderwochen und die Jugendfreizeiten entstanden sind. 138
Читать дальше