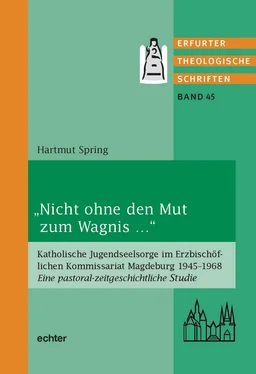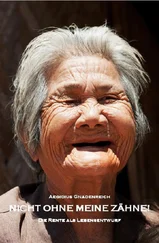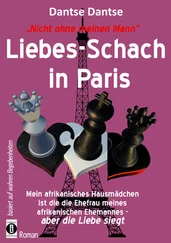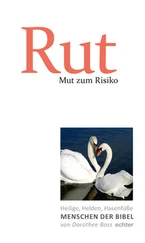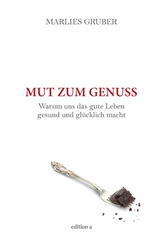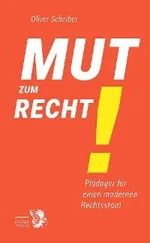Zu den bereits angeführten Überlegungen kommt noch ein weiterer Gesichtspunkt hinzu. Die Seelsorge in Deutschland und damit auch die Jugendseelsorge waren nach der Unterdrückung während der NS-Zeit von einem gewissem Rigorismus geprägt, der aus der Erfahrung der vorangegangenen Jahre gelernt hatte, welche Folgen ein Rückzug auf den religiösen Bereich haben konnte. Diese Art von gesellschaftlicher Ausgrenzung sollte sich nach dem Kriegsende nicht wiederholen. Einerseits hatte die katholische Kirche durch die Unterdrückung in der Zeit der Nationalsozialisten eine gesellschaftliche Marginalisierung erlitten. Andererseits wurde durch den äußeren Druck der nationalsozialistischen Diktatur eine Differenzierung eingeleitet, zwischen dem auf rituelles Tun beschränkten Teil der Katholiken und denen, die unter den schwerer werdenden Bedingungen aus ihrem Verständnis von christlicher Nachfolge heraus sich mehr und mehr als Minderheit erlebten und zum Widerstehen verpflichtet fühlten. Dieser Teil war unter den neuen gesellschaftlichen Bedingungen gegebenenfalls zum Widerstand auch gegen das sich einrichtende sozialistische Gesellschaftssystem bereit. Ähnliches traf auch für die katholischen Jugendlichen der Diaspora zu. Das gelebte Katholische „in der Fremde“ verlangte ein stärkeres persönliches Engagement, um „in der Zerstreuung“ überleben zu können. Überdies gab es bei den Jugendlichen noch eine stärkere Identifizierung mit Idealen der katholischen Jugend aus der Zeit des Deutschen Reiches, die getragen wurde vom Engagement einzelner, der so genannten „Elite“, 31mit dem Wissen, dass die katholische Kirche in der Diaspora nur als engagierte und nicht, 32im Kontrast zum dominant evangelisch geprägten Umfeld, als volkskirchliche eine Chance hatte. 33Ganz im Gegensatz dazu stand die Hoffnung auf die Wiederherstellung Weimarer Verhältnisse und das Erstarken des Katholischen in Mitteldeutschland bei den Ordinarien. Beide Strömungen prallten in der sich konstituierenden Jugendseelsorge Mitteldeutschlands aufeinander und mussten von ihr als zusätzliche Hypothek bewältigt werden.
1 Der politische Rahmen in der SBZ
Der Zeitraum zwischen 1945 und 1950 war einerseits durch das Kriegsende und andererseits durch den Beginn des Kalten Krieges und die Zeit des sich anbahnenden „Kirchenkampfes“ bestimmt. In dieser Zeit ging es den Siegermächten und deren Verbündeten zunächst vor allem darum, das Macht- wie auch das geistige Vakuum im Nachkriegsdeutschland auszufüllen. Auch die katholische Kirche sah darin für sich eine wichtige Aufgabe. Wegen ihrer zum Teil kritischen Haltung gegenüber den Nationalsozialisten sprach ihr die Besatzungsmacht in der SBZ zunächst einen relativ großen Gestaltungsspielraum zu, auch wenn dieser schon kurze Zeit später durch die gleichgeschaltete Politik von SMAD und KPD bzw. SED wieder beschnitten wurde. So bekamen die Rekatholisierungshoffnungen im Nachkriegsdeutschland nur im Westen Deutschlands durch die einsetzende Demokratisierung neue Nahrung. Im „Osten“ wurden diese Hoffnungen durch die Erfahrungen mit der sowjetischen Besatzung und der neuen Regierung sehr schnell gedämpft. Denn schon bald war offensichtlich, die eigentlichen Motive der SMAD und der kommunistischen Kader für die Annäherung an die Kirchen lagen darin begründet, diese politisch instrumentalisieren zu wollen. 34Daher kamen die alten „Feindbilder“ bald wieder zum Tragen. Ein ausgewiesener Antibolschewismus hatte bereits in der Zeit der Weimarer Republik die Position der katholischen Kirche gegenüber der atheistischen Sowjetunion geprägt. 35Dieser verfestigte sich nach dem Krieg, als nicht nur die Kirchen in der SBZ eine „Bolschewisierung“ durch die sowjetische Besatzung erfahren mussten. 36Ab 1945 lebte die Bevölkerung in der SBZ unter dem direkten Einfluss des „Bolschewismus“, was bei vielen Katholiken eine großen Angst vor „den Russen“, der Verkörperung des „Antichristen“, auslöste. Diese Angst war speziell bei den Vertriebenen oft mit persönlichen Erfahrungen aus den letzten Kriegsmonaten unterlegt. 37Durch die tagtäglichen Erfahrungen willkürlicher Entscheidungen der sowjetischen Besatzungsmacht und mit den Übergriffen der Soldaten bekam dieses Gefühl ständig neue Nahrung. 38
Die Skepsis gegenüber „den Russen“ übertrug sich auch auf die von den sowjetischen Behörden eingesetzten und unterstützten Funktionäre, die mit Aufnahme ihrer politischen Arbeit an ihren Ziel, dem Aufbau einer neuen „Staatspartei“, keinen Zweifel aufkommen ließen. 39Daher waren die Funktionäre bestrebt, die „Jugend nicht durch Popen verwirren [zu] lassen.” 40Sie versuchten den gesellschaftlichen Einfluss der Kirche zu minimieren und „durch schnelles Handeln die Jugend für sich zu gewinnen, galt diese doch gemeinhin als ‚orientierungslos’ und ‚suchend’“. 41An der grundsätzlichen Gegnerschaft zwischen Kirche und Kommunisten, egal ob sowjetischer oder deutscher Herkunft, bestand also von Anfang an kein Zweifel. 42Bereits zu Beginn des Aufbaus neuer gesellschaftlicher Strukturen im Nachkriegsdeutschland war dies der Grund für die Skepsis, mit der sich die katholischen Vertreter bei aller Aufbruchsstimmung und Loyalität in den neu entstehenden Jugendgremien eher zurückhielten. Trotzdem gab es Seelsorger und Jugendliche, die sich in den neu gebildeten politischen Gremien in der SBZ bis hin in die Leitungsebene engagierten. 43Unbeschadet vieler Vorbehalte wurde seitens der Ordinarien die Mitarbeit der Jugendvertreter in den staatlichen Jugendgremien zunächst grundsätzlich bejaht. Von 1945 bis zum III. Parlament der FDJ 1949 war die katholische Kirche unter anderem im Zentralen Jugendausschuss und in der FDJ-Leitung vertreten. Auch wenn es heute in Vergessenheit geraten zu sein scheint, dass unter den Mitunterzeichnern der Gründungsurkunde der FDJ die Namen des katholischen Jugendführers M. Klein 44und des katholischen Jugendseelsorger R. Lange aus Berlin stehen, war diese Tatsache für die ersten Nachkriegsjahre für beide Seiten von außerordentlicher Bedeutung. Bereits kurze Zeit später sollte diese Kooperation der katholischen Kirche nichts mehr nutzen, die FDJ begann sie zu vertuschen. 45
Aufgrund der unterschiedlichen Interessen gab es innerhalb der Zweckbündnisse zwischen Kirche und Kommunisten von Anfang an Spannungen in den verschiedenen Gremien, so z. B. bereits bei der Zusammenarbeit im Zentralen Jugendausschuss. 46Trotzdem wurde das Miteinander seitens der katholischen Kirche solange als möglich aufrechterhalten. Denn für den Aufbau einer eigenen Jugendseelsorge war die katholische Kirche vom Wohlwollen der staatlichen Stellen abhängig. Diese Möglichkeit wollten die Verantwortungsträger der Kirche durch eine grundsätzliche Verweigerung der Kooperation nicht aufs Spiel setzen. Über die Art und Weise der Zusammenarbeit mit der staatlichen Jugendorganisation gab es zu diesem Zeitpunkt noch keine einheitliche Auffassung innerhalb der katholischen Kirche. 47Die katholischen Vertreter standen zunächst dem Einheitsgedanken mit einer zentralen Jugendorganisation nicht unbedingt ablehnend gegenüber. 48Tendenziell sollte aus Sicht der ostdeutschen Ordinarien zu keinem Zeitpunkt eine eigene katholische Jugendorganisation in der SBZ aufgebaut werden. Denn schon früh war abzusehen, dass eine katholische Jugendorganisation unter den Bedingungen der SBZ keine Chance haben würde. Noch weniger sollte Arbeit an der katholischen Jugend der FDJ überlassen bleiben. Vielmehr war es das Anliegen der Ordinarien, die noch nicht flächendeckend vorhandenen Strukturen der Pfarrjugendseelsorge von den Städten auf die gesamte SBZ auszuweiten.
Wenn noch der Befehl Nr. 2 der SMAD vom 10. Juni 1945 49die Bildung von antifaschistischen Organisationen verschiedenster Arten und damit implizit auch von verschiedenen Jugendorganisationen zuließ, so schloss bereits der Aufruf der sowjetischen Militärverwaltung vom 31. Juli 1945 zur Bildung von Jugendausschüssen in Städten explizit andere als antifaschistische Jugendorganisationen aus. 50Antifaschistisch wurde in der Folgezeit aber immer enger im Sinne von „einheitssozialistisch“ interpretiert. Die häufig gemachte Erfahrung der katholischen Kirche, von den staatlichen Stellen vereinnahmt oder zurückgedrängt zu werden, traf auch für den Bereich der Jugendarbeit zu. 51Dabei wurde anfangs von sowjetischer Seite sogar noch regulierend eingegriffen. Vor allem dann, wenn eingesetzte KPD/SED-Funktionäre zu radikal bei der Gleichschaltung aller „antifaschistischen” Kräfte vorgingen. 52Die Gestaltungsmöglichkeiten der kirchlichen Vertreter in den staatlichen Jugendgremien aber blieben von Anfang an begrenzt. Bemühten sich die Kirchen, den ihnen eingeräumten Handlungsspielraum zu erhalten, wurde von der staatlichen Seite aus versucht, die Kirchenpolitik für ihre eigenen Interessen zu funktionalisieren. Sie war vor allem Mittel zu dem Zweck, möglichst alle Bereiche gesellschaftlichen Lebens kontrollieren zu können.
Читать дальше