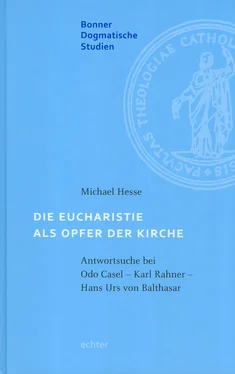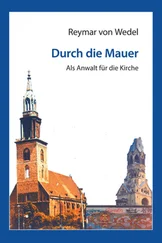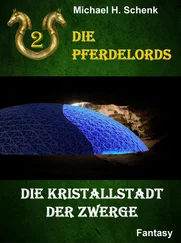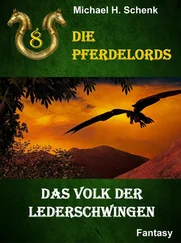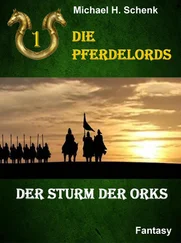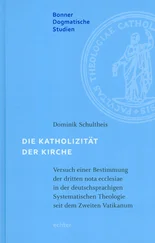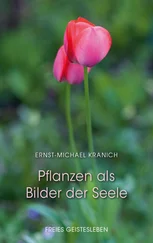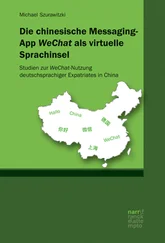„Die Vermischung der rituellen mit der dogmatischen Sprechweise oder gar die Identifizierung eines allgemein kultischen Opferbegriffs mit der neutestamentlichen Rede vom Opfer Jesu Christi und der Christen führt in neue Schwierigkeiten.“ 156
Im weiteren Verlauf der Theologiegeschichte entstehen sogenannte „Messopfertheorien“. Sie zeugen davon, dass Trient eben keine Definition vom Wesen des Messopfers gibt. Durch die fehlende Unterscheidung der liturgischen von der dogmatischen Sprechweise, d.h. die Identifikation des liturgischen offerre mit dem biblischen offerre der Selbsthingabe, sucht man den Akt der Darbringung an Gott in der Dimension des Zeichens, im liturgischen Geschehen selbst. Im Ergebnis entstehen Messopfertheorien, die in vorchristliche Opfervorstellungen zurückfallen. 157Eine kurze Skizzierung dieser Theorien schließt sich hier nach einem Vorausblick an.
Die unterschiedliche Verstehensweise bezüglich des Opfercharakters in den Konfessionen 158, die nach Reformation und Trienter Konzil über Jahrhunderte hinweg die gegenseitige Verurteilung bedeutet, ist heute zu einem differenzierteren Dialog gewendet. Luthers kategorisches Nein zum Opfercharakter der Messe ist heute nicht mehr Richtschnur im ökumenischen Dialog. Viele Gesprächsansätze zwischen den Konfessionen lassen die Hoffnung aufkeimen, dieses schwierige Thema im ökumenischen Dialog tiefer zu ergründen. Es ging bei unserer Darstellung bisher ja um die historische Einordung und Denkstruktur in den Jahrhunderten vor und nach der Reformation und die Antwort des Konzils von Trient. In der Reformation präzisiert sich die Kritik an der Messopferlehre dahingehend, dass man um die Einzigartigkeit und Vollgenügsamkeit des Kreuzesopfers Jesu Christi bangt, weil es keiner multiplizierenden Wiederholung noch hinzufügenden Ergänzung bedarf. Doch gerade dieses Bekenntnis zur Einzigkeit und Vollgenügsamkeit des Versöhnungsgeschehens in Jesus Christus unterstreicht das Trienter Konzil eindeutig, insofern das Messopfer als Vergegenwärtigung (repraesentatio) des einmaligen Selbstopfers Jesu Christi am Kreuz bestimmt wird. Evangelische und römisch-katholische Seite stimmen somit darin überein, dass das Kreuzesopfer Jesu Christi nicht fortgesetzt, noch wiederholt oder ersetzt oder ergänzt werden kann. 159Der ökumenische Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen erklärt deswegen 1986:
„Es hat sich als möglich erwiesen, die gläubige Überzeugung von der Einzigkeit und Vollgenügsamkeit des Kreuzesopfers Jesu Christi und von der Tragweite seiner Anamnese in der Eucharistiefeier der Kirche gemeinsam auszusagen. Auf der Basis dieses gemeinsamen Opferverständnisses … kann festgestellt werden: Sowohl die scharfe Kritik der Schmalkaldischen Artikel und des Heidelberger Katechismus als auch die verurteilende Zurückweisung reformatorischer Positionen durch das Konzil von Trient waren schon im 16. Jahrhundert teilweise nicht gerechtfertigt, treffen jedenfalls heute den Dialogpartner nicht mehr. Die ‚Messopferkontroverse’ und ihr kirchentrennender Charakter sind damit überholt. Insofern der Verdacht der ‚Werkerei’ durch dieses Opferverständnis als un begründet erwiesen ist, gilt diese Feststellung auch für die ‚Messen für die Verstorbenen’… “ 160
Hier ist ebenfalls der Bericht „Das Opfer Jesu Christi und der Kirche“ des Ökumenischen Arbeitskreises evangelischer und katholischer Theologen von 1983 zu nennen, der sich in differenzierter Weise mit der Problematik auseinandersetzt. 161Eine Zusammenstellung über die Frage der Eucharistie als Opfer im ökumenischen Dialog hat 1989 Elisabeth Hönig vorgelegt und den Stand der ökumenischen Entwicklung zu diesem Zeitpunkt festgehalten. 162Kehren wir aber nach diesem Ausblick zurück in die Zeit der tridentinischen Rezeptionsgeschichte.
§5 Messopfertheorien
1.Offene Fragen im Nachklang des Konzils von Trient
Die Diskussion in Trient und die Textwendungen des Messopferdekretes zeigen die Schwierigkeiten der Konzilsväter, das Geheimnis der Einheit bei gleichzeitiger Differenz von Kreuzes- und Messopfer mit theologischen Mitteln zu beschreiben. Die Messe darf kein bloßes Andenken sein, oder gar die Annahme eines zweiten unblutigen Opfers, um die Einmaligkeit des Kreuzesopfers nicht zu verlieren. Der grundlegende Ansatz zur Lösung der konfessionellen Verständnisschwierigkeiten liegt in der Aufhebung der Unterscheidung von sacrificium (Opfer) und sacramentum (Sakrament) in Lehre und Praxis der Eucharistie. 163
„Erscheint der sakramentale Akt der Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers in der Opfergabe vom Vollzug der Darbringung dieser Gabe getrennt, dann kann der Vollzug des Messopfers nicht mehr als sakramentale Vergegenwärtigung des einmaligen Kreuzesopfers stimmig begriffen werden.“ 164
Die aufkommenden Theorien suchen also den Zusammenhang des „sacrificium visibile“ der Messfeier mit dem „sacrificium reale“ am Kreuz in der konkreten Gestalt des liturgischen Vollzuges der Messfeier, wobei ein besonderes Augenmerk auf die Doppelkonsekration gelegt wird, die Trennung von Fleisch und Blut des Herrn, als dem Akt des Sterbens Jesu und seiner Lebenshingabe durch den Kreuzestod. 165
Die katholische Sakramententheologie setzt nunmehr den Akzent auf die Wirksamkeit und führt den scholastischen Ansatz weiter, als Abgrenzung zum Protestantismus. Das Problem, das durch die Reformatoren in die Diskussion rückte, zeigt sich in der Konzilsaussage fassbar: Wie kann man das Messopfer als relatives, vollkommen vom Kreuzesopfer abhängiges und zugleich als wahres und eigentliches Opfer bestimmen? Im Umfeld dieser zentralen Frage entwickeln sich mehrere Lösungsansätze. Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie sich an einem religionsgeschichtlichen Opferbegriff orientieren. Der personale Hingabeakt Jesu an den Vater, in den sich die Gläubigen durch Akte der Gottes- und Nächstenliebe hineinnehmen lassen, ist nicht zum Charakteristikum des Opferbegriffes gewählt. Der christologische Bezugspunkt bleibt somit unvermittelt, d.h., dass sich der Opfercharakter von der personalen auf eine materielle Ebene verlagert. 166
Diese verschiedenen Lösungsversuche, die sich teilweise nur in Nuancen unterscheiden, fasst man heute unter den Begriff „Messopfertheorien“ zusammen. Ihre Übereinstimmung liegt darin, das Wesen des Messopfers von einem allgemeinen religionsphänomenologischen Opferbegriff und Opferverständnis her- und abzuleiten. 167
„Das Tun der Kirche im Abendmahl ist aber nicht nur als das Geltendmachen und Vorbringen des einmaligen Opfers Christi, sondern auch als Opferung Christi durch die Kirche im Herrenmahl gedeutet worden. Diese Opferung Christi durch die Kirche im Herrenmahl ist als unblutige Wiederholung des einmaligen blutigen Kreuzesopfers bezeichnet worden. Zwischen dem Vorhalten des ein für allemal vollbrachten Kreuzesopfers und dem Nachvollzug der Opferung Christi im Herrenmahl besteht ein erheblicher Unterschied.“ 168
Ziel der Messopfertheorien ist es, den vom Konzil von Trient weitgefassten Opferbegriff, zu fixieren und ausführlich darzustellen. Sie bemühen sich daher darum, in der Messe das reale Opfermoment nachzuweisen, „das sowohl den Ansprüchen eines relativen wie auch denen eines eigentlichen kultischen Opfers genügen sollte.“ 169Trient hat durch den Ausdruck verum et proprium sacrificium die Messe zu etwas erklärt, das als ein absolutes Opfer, besser gesagt, echtes und eigentliches Opfer im zeichenhaften Vollzug, aufgefasst werden kann. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es sich dabei um ein eigenständiges Opfer handelt! 170Man kann den Theologen, die die Messopfertheorien erarbeiten, nicht absprechen, sich um die Sicherung der Stiftung Christi zu bemühen. Die verschiedensten Theorien beruhen jedoch auf Voraussetzungen, die eine umfassende Würdigung des Geheimnisses des eucharistischen Opfers verhindern. Zu den Mängeln zählen die ausschließlich spekulativ-dogmatischen Ansätze, ohne Einbeziehung der liturgischen Gestalt der Messfeier, d.h. der in der Liturgie vorhandene Lob- und Dankcharakter im Tun der Gemeinde wird nicht berücksichtigt. Zugleich wird der Opfercharakter isoliert von der sakramentalen Grundstruktur der Eucharistie betrachtet. Hier vollzieht sich der Schritt zu einem naturhaften Opferverständnis, wie bei den Reformatoren. Die nachtridentinischen Überlegungen verlegen eindeutig das Opfermoment der Messe in einen naturhaften Vorgang, der bei dem unter den Gestalten von Brot und Wein gegenwärtigen Christus lokalisiert wird. 171
Читать дальше