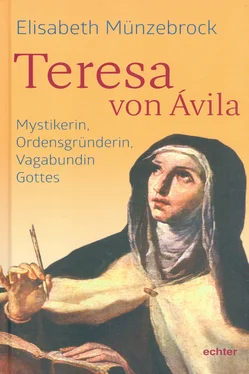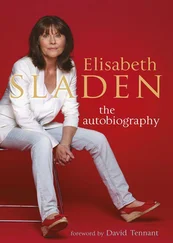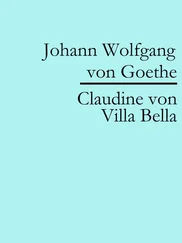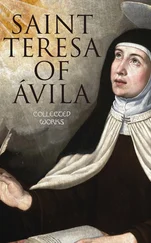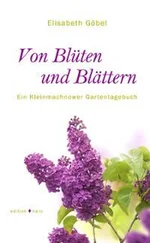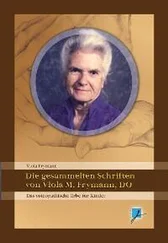Teresa selbst analysiert hier sehr präzise die „Gefahren“, bei diesen „Spielchen“ eventuell ihre „Ehre“ zu verlieren, und trifft damit den Nagel auf den Kopf. Das Bewahren der Ehre ist ein absolutes „Muss“ für die Gesellschaft des spanischen 16. Jahrhunderts. Und so begibt Teresa sich auf eine andauernde „Gratwanderung“, wie sie uns selbst berichtet: „ Diese Furcht gab mir die Kraft, meinen guten Ruf nicht ganz zu verlieren, und ich glaube, ich hätte mich durch nichts auf der Welt hiervon abbringen lassen, noch hätte die Liebe zu einem Menschen mich dazu verführt, in diesem Punkt nachzugeben“ (V 2,3).
Dennoch gelingt es einer „ Verwandten “, die es mit dem „guten Ruf“ nicht allzu genau nimmt, Teresa in die Scheinwelt des galanten Zeitvertreibs, der Tändeleien und „Liebeleien“ einzuführen; „ dafür nahm ich alles, was mir schadete, von einer Verwandten an, die oft in unserem Hause verkehrte. Sie pflegte so leichtfertigen Umgang, dass meine Mutter alles darangesetzt hatte, sie von unserem Haus fernzuhalten (V 2,3).
Teresa differenziert auch in der Folge ihres Berichts schonungslos: „ Später, nachdem diese Furcht ganz weg war, blieb mir nur noch die um mein Ansehen, die mich bei allem, was ich tat, in Qual versetzte. In der Hoffnung, dass es nicht bekannt würde, wagte ich vieles, was gegen mein Ansehen und auch gegen Gott gerichtet war (V 2,5). Teresas „Scharfsinn“ erspäht alle Gelegenheiten, ihrem „riskanten Zeitvertreib“ nachzugehen, und es scheint dann auch eine erste Liebe ins Spiel zu kommen, sodass Teresa erwägt, das Ganze der normalen Lösung in einer Ehe zuzuführen.
Erneute Wende und „Zwischenstation“ bei den Augustinerinnen
Eben wegen jenes „riskanten Zeitvertreibs“ sieht ihr Vater sich schließlich genötigt, seine 17-jährige bildhübsche und geistreiche Tochter in das Kloster der Augustinerinnen, ein Stift für adelige junge Mädchen, zu stecken, wo Teresa durch ihr gewinnendes Wesen sogleich die Herzen erobert und sich ihre bislang ausgeprägte Abneigung gegen den Ordensstand mindert.
Eine besondere Rolle kommt hierbei der dortigen Leiterin, Doña María de Briceño, zu, einer hochgebildeten, feinsinnigen und frommen Ordensfrau, die es versteht, Teresas unruhigen Geist zu führen und ihr verschüttetes Interesse für „die ewigen Dinge“ wieder zu erwecken: „ Als ich an der guten und frommen Unterhaltung mit dieser Schwester zunehmend Gefallen fand, freute es mich zu hören, wie gut sie von Gott sprach“ (V 3). Noch als reife Frau erinnert Teresa sich daran, dass für die Berufung der besagten Klosterfrau das Matthäus-Zitat „Viele sind berufen, wenige aber auserwählt“ (Mt 20,16) ausschlaggebend gewesen war (V 3,1).
Gott rückt wieder mehr in den Mittelpunkt von Teresas Denken und Beten. Während sie sich zunächst mit dem mündlichen Beten begnügt, einem Beten mit vorgegebenen Worten, taucht erneut ein Thema auf, das sie fortan lebenslang begleiten wird: Sie wendet sich in der Meditation dem leidenden Herrn zu, um ihn in seiner Not zu trösten.
Es beginnt eine dreimonatige harte Zeit der „Güterabwägung“: Ehe gegen Klostereintritt – wobei sie wiederum beinahe „knallhart“ kalkuliert, wenn sie gesteht: „ In diesem Kampf verbrachte ich drei Monate, wobei ich mir mit folgender Argumentation Zwang antat: dass die Härten und die Qual eines Lebens im Kloster nicht größer sein könnten als die des Fegefeuers, dass ich aber sehr wohl die Hölle verdient hatte, und dass es nicht viel bedeutete, mein Leben wie in einem Fegefeuer zu verbringen, weil ich danach geradewegs in den Himmel kommen würde, was ja ohnehin mein Wunsch war“ (V 3,6).
Und an anderer Stelle verhehlt Teresa auch nicht, dass sie nicht bereit war, die dauerhaften Mühen einer Ehe mit andauernden Schwangerschaften – wie sie es an ihrer Mutter leidvoll erlebt hatte – auf sich zu nehmen.
3.Teresas beschwerlicher Weg ins „Menschwerdungskloster“ (1535) und die folgenden „dürren Jahre“
Teresa ist hin- und hergerissen: Einerseits zieht es sie zu einem standesgemäßen Leben mit Festen und guten Freunden, andererseits bricht erneut und mit Macht diese „unstillbare Sehnsucht“ ihrer Kindheit nach einem „Seelenheil „ für immer und ewig“ in ihr auf. Schließlich ergreift Gott selbst die Zügel … „Obwohl ich in dieser Zeit ziemlich um mein Seelenheil besorgt war, lag dem Herrn noch mehr daran, mich auf die Lebensform vorzubereiten, die am besten für mich war. Er ließ mich sehr krank werden, so dass ich zu meinem Vater nach Hause zurückkehren musste. (…) Als ich wieder gesund war, brachte man mich zu meiner Schwester, die in einem nahegelegenen Dorf wohnte, denn ihre Liebe zu mir war extrem (…) .
Auf dem Weg dorthin lebte ein Bruder meines Vaters, ein sehr gebildeter und tugendhafter Witwer, den der Herr mehr und mehr darauf vorbereitete, ihn an sich zu ziehen (…). Er wollte, dass ich einige Tage bei ihm verbrachte. Seine Beschäftigung bestand in der Lektüre guter Bücher in der Muttersprache und seine Gespräche waren auf Gott und die Nichtigkeit der Welt gerichtet. Er bat mich, ihm vorzulesen, und obwohl mich seine Bücher nicht wirklich interessierten, tat ich so als ob. In diesem Punkt, anderen eine Freude zu machen, war ich extrem, auch wenn es mir schwerfiel (…) .
Wenn ich auch nur wenige Tage dort blieb, erinnerte ich mich durch die Kraft, mit der sich die gelesenen oder gehörten Worte Gottes in mein Herz einprägten, und durch die gute Gesellschaft an die Wahrheit meiner Kindheit, die Nichtigkeit und Vergänglichkeit dieser Welt, und ich fühlte Angst in mir hochsteigen, dass ich in die Hölle käme, wenn ich jetzt sterben würde. Und wenn mein Wille auch noch nicht zu einem Eintritt ins Kloster bereit war, so sah ich doch ein, dass dies wohl die beste und sicherste Lebensform wäre, und beschloss, mich nach und nach zum Eintritt in ein Kloster zu zwingen (V 3,3 ff.).
Teresas rätselhafte Krankheiten und ein „Klostereintritt aus Höllenfurcht“
Wir begegnen hier einem weiteren für Teresa charakteristischen Phänomen: ihren lebenslangen Krankheiten, die einerseits – nach heutigem Verständnis – Ausdruck eines permanenten Somatisierungsprozesses waren, sich andererseits aber durch die nie endenden inneren Spannungen zwischen dem, was sie im Gebet zu erkennen glaubte, und ihrer „ungenügenden Ant-Wort“ erklären lassen: „Es befielen mich neben Fieberschüben auch immer wieder starke Ohnmachtsanfälle, da ich schon immer eine sehr schwache Gesundheit hatte. Indessen erfüllte mich die Freude an guten Büchern mit Leben. So las ich in den Briefen des hl. Hieronymus, die mir so viel Mut machten, dass ich mich entschloss, meinen Vater in meine Klosterpläne einzuweihen, was schon fast so viel war, wie den Habit zu nehmen. Denn ich war so besorgt um meine Ehre, dass ich diesen Schritt niemals zurückgenommen hätte, sobald ich ihn einmal ausgesprochen hatte (V 3,7).
Am 2. November 1535 tritt Teresa – aus Höllenfurcht, wie sie selber bekennt – in den Karmel von der Menschwerdung (Encarnación) zu Ávila ein, wo sie ein Jahr später eingekleidet wird und am 3. November 1537 Profess ablegt. „ Ich erinnere mich noch ganz genau daran, dass der Schmerz, den ich empfand, als ich das Haus meines Vaters verließ, nicht stärker sein konnte, als wenn ich stürbe, denn mir war es, als löste sich jeder Knochen einzeln aus meinem Körper“ (V 4,1).
Immerhin stellt sich – vorübergehend – eine Art innerer Glückszustand bei Teresa ein: Sie, die an Geschmeide und Wohlleben gewöhnte und „verwöhnte“ junge Adelige, empfindet plötzlich eine innere Genugtuung beim Kehren der Klostergänge und bei anderen haushaltlichen Tätigkeiten, wenngleich sie im Kloster – ihrem Status gemäß – noch eine Dienerin bei sich hat.
Читать дальше