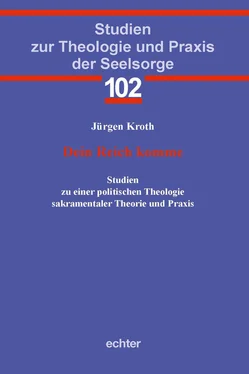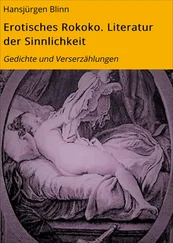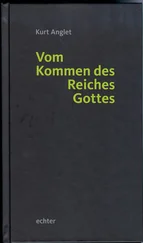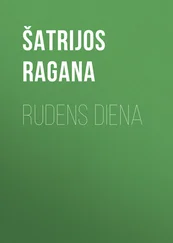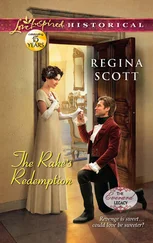Nun sind aber schon von sich aus menschliche Bedürfnisse offensichtlich expansiv und neigen nur selten dazu, sich mit Bestehendem oder Vorhandenem zufrieden zu geben. Selbstverständlich gibt es hier Ausnahmen, aber sie bestätigen doch wohl immer wieder nur die Regel. Wenn dies aber stimmt und wenn weiterhin richtig ist, dass nicht jedes Bedürfnis gleichermaßen befriedigt werden kann, wenn daher unterschiedliche, in freier Subjektivität artikulierte Bedürfnisse anderen frei artikulierten Bedürfnissen gegenübertreten, dann ergibt sich daraus zum einen ein der Bedürfniswelt immanentes Aggressions- und Konfliktpotential, dann stellt sich aber auch eine gesellschaftliche Tendenz ein, die progressiven Bedürfnisse in möglichst großer Anzahl zu befriedigen; kurz gesprochen: ein expandierender Markt sucht danach, dies zu regulieren, was freilich auf Erschließung immer neuer Ressourcen hinausläuft.
Wird dabei aber eine bestimmte Schwelle überschritten, indem die Kontrolle der Bedürfnisbefriedigung an die Bedürfnisartikulation gebunden bliebe, beginnt sich der Prozess zu verselbständigen. Das bedeutet, dass ab dann ständig neu die Bedürfnisse selbst produziert werden müssen und das Bedürfnissubjekt seinerseits mehr und mehr durch die Bedürfnisproduktion zu einem Bedürfnisobjekt wird. Diese Entwicklung ist unschwer von den meisten Menschen nachzuvollziehen. Dass diese Logik der Expansion nicht beliebig fortsetzbar ist, ist ebenso evident wie offensichtlich folgenlos, obwohl doch die Folgen inzwischen nicht nur in den Ländern der sog. Dritten Welt sichtbar sind, sondern zunehmend auch hier bei uns. 21Jenseits aber der ökonomischen und ökologischen Auswirkungen zeigen sich in den westeuropäischen Ländern auch noch andere Folgen, die für eine pastoraltheologische und religionspädagogische Theorie und Praxis ebenfalls bedeutsam sind: nämlich die psychosozialen Folgen der Zerstörung eigenständiger Subjekte, Adorno spricht gar von der „Liquidation des Ichs“. Anhand eines kleinen Beispiels soll die Verkehrung der Verhältnisse in einem ganz anderen Bereich verdeutlicht werden:
„Statt, daß eine zur Vernunft gekommene Menschheit die gigantischen materiellen und intellektuellen Kräfte, die sich im Schoße der kapitalistischen Produktionsweise entwickelt haben, zur Einrichtung einer freien Gesellschaft einsetzt, wird sie mehr und mehr zum Anhängsel des kapitalfixierten technischen Fortschritts, der sich vollständig von seinen Erzeugern losgerissen hat und diese wie bloße Anhängsel mitschleift. Eine symbolische Darstellung dieses Sachverhalts hat kürzlich ein englisches Busunternehmen geliefert, dessen Busfahrer die Wartenden an den Haltestellen nur selten mitnahmen. Als sich die verschmähten Fahrgäste eines Tages beschwerten, bekamen sie vom Unternehmer die verblüffende Erklärung, anders könne der strikte Fahrplan nicht eingehalten werden.“ 22
2.3 Die Herausforderung unbegrenzter Pluralität
Die zweifellos gestiegenen Möglichkeiten, aus allen denkbaren Angeboten zu wählen, haben für das Subjekt auf den ersten Blick eine Freiheit eröffnende Funktion. Beim zweiten Blick sieht die Sache aber schon etwas anders aus: Die Möglichkeit, aus allem wählen zu können, führt zu einer „neuen Unübersichtlichkeit“ 23. Das spätmoderne Subjekt weiß, dass es alles wählen kann, und steht angesichts dieser Möglichkeit völlig überfordert da. Ohne übergeordnetes Bezugssystem – sei es religiös, sei es philosophisch, politisch oder ästhetisch – bleibt dem Einzelnen nichts anderes übrig, als eigenständig Sinn zu produzieren oder auf eigene Sinnressourcen zu rekurrieren. Angesichts radikaler Pluralität fällt nun aber eine wie auch immer geartete soziale Kommunikation immer schwieriger. Dass sie nicht unmöglich ist, ist gleichwohl evident und damit zugleich auch Möglichkeit von Hoffnung; doch dies ginge dann selbstverständlich über den Postmodernismus hinaus. Ein Blick in unsere Wirklichkeit zeigt aber deutlich, dass es mit einer sozialen Kommunikationsstruktur immer schwieriger wird. Immer mehr wird das Subjekt auf sich selbst zurückgeworfen, immer stärker werden die Vereinzelungs-, Atomisierungs- und Vereinsamungstendenzen. Das Individuum muss demgemäß „lernen, sich selbst als Handlungszentrum, als Planungsbüro in Bezug auf seinen eigenen Lebenslauf, seine Fähigkeiten, Orientierungen, Partnerschaften usw. zu begreifen“ 24; jeder ist also seine eigene Ich-AG.
Mit der letzten Bemerkung wird schon angedeutet, dass der früher kritisch verwendete Begriff der Atomisierung und sozialer Entfremdung inzwischen affirmativ verwendet wird, denn in der Gesellschaft möglichst vieler Ich-AGs ist jeder sein eigener Unternehmer, sein eigener Chef, sein eigener Planer und sein eigener Angestellter. Es entsteht damit eine doppelte Pluralität: eine interpersonale und eine intrapersonale. Wie die Subjekte untereinander in unverbundener Konkurrenz stehen, so muss auch das Subjekt in sich selbst sehr plural aufgestellt sein und unterschiedliche Fähigkeiten mitbringen.
Für die praktisch-theologische Perspektive stellt sich die Frage, ob sie diesen Trend prolongieren und theologisch verdoppeln darf, oder ob sie nicht bewusst an der Problematisierung und Überwindung der gesellschaftlichen Atomisierung mitarbeiten muss.
Schwierig ist das aber nicht nur deswegen, weil sich die kirchliche Praxis schon seit langer Zeit als Spielart bürgerlicher Religion erwiesen hat, sondern auch weil sich dies in der religiösen Sozialisation konsequent in Richtung einer religiösen Individualisierung und individualisierten Religiosität entfaltet hat. Dabei führt erstere tendenziell zur Auflösung der letzteren, zumindest in dem Sinne, dass unter dem Zeichen der Individualisierung es zu einer Auflösung des transindividuellen Religiösen kommen kann. Nun kann die Reaktion darauf nur schwer sein, den individualisierten und atomisierten Subjekten ein geschlossenes System vorgeprägter Religiosität vorzulegen, das freilich ohnehin kaum noch gelebt, sondern nur noch gelehrt wird. Triftiger scheint es vielmehr, mithilfe der großen Erzählung der jüdischchristlichen Tradition ein Deutungsmuster vorzulegen, das sich einerseits in Geschichte und Gesellschaft selbst entfaltete und darin schließlich auch ihr fundamentum in re besitzt, das zugleich aber auch für Gegenwart und Zukunft die Kraft produktiver Ungleichzeitigkeit besitzt, die in der radikalen Pluralität und den damit verbundenen Atomisierungstendenzen auf ein Einheitsmoment setzt, das nunmehr Menschen nicht mehr isoliert, sondern in ihrer Andersartigkeit verbindet und so auch die Möglichkeit von Sozialität und Solidarität auch weit über den Horizont des Eigenen hinaus eröffnet.
Wie wenig eine wirkliche Durchdringung der Pluralitätsproblematik vorgenommen wird, kann in einem ganz anderen Bereich verdeutlicht werden: Schaut man sich etwa Lehrpläne für den Religionsunterricht an, dann trifft man mit großer Wahrscheinlichkeit auf Themen, die mit den Weltreligionen verbunden sind, selten aber auf das, was heute unter dem Stichwort ‚interkulturelles Lernen’ verstanden wird. Wer sich dagegen in der religionspädagogischen Fachliteratur seit den 90er Jahren umschaut, erhält einen völlig anderen Eindruck: Interkulturelles Lernen scheint ein breit rezipierter Ansatz religionspädagogischer Theorie und Praxis zu sein. In Fachzeitschriften werden Themenhefte dazu aufgelegt, es werden entsprechende Sammelbände verfasst und auch Monographien vorgelegt. 25Nun könnte es sich dabei selbstverständlich um ein Modethema handeln oder aber es spiegelt sich darin eine Erfahrung wider, die auf die Notwendigkeit einer Beschäftigung damit hinweist.
Dass in allen gesellschaftlichen Bereichen und damit auch in Kirche, Gemeinde, Schule und Theologie die Pluralität zugenommen hat, ist inzwischen ein Allgemeinplatz. Es stellt sich aber die Frage nach den Beziehungen der unterschiedlichen pluralen Erscheinungen. Gibt es mithin Beziehungen zwischen den einzelnen Konfessionen, zwischen den monotheistischen Religionen und den übrigen Weltreligionen? Selbstverständlich haben wir schon eine gewisse Erfahrung mit interkonfessionellen Strukturen, was uns aber noch immer fehlt, sind interreligiöse Ansätze. Dabei stellt sich sogleich das Problem, wie denn eine Auseinandersetzung zwischen den Religionen möglich ist, ohne den jeweiligen Wahrheitsanspruch zu relativieren, ohne ihn freilich auch zu verabsolutieren.
Читать дальше