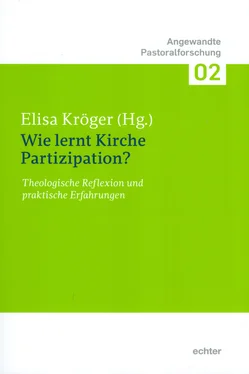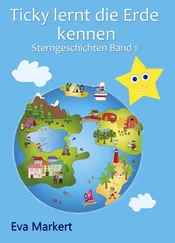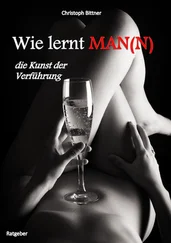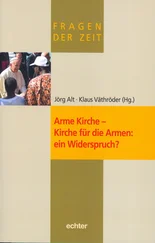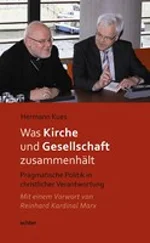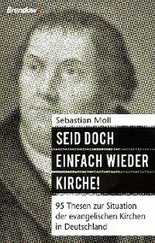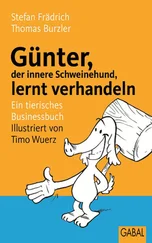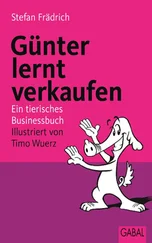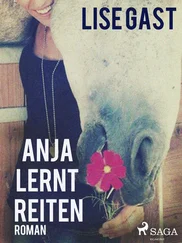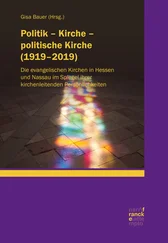1 ...8 9 10 12 13 14 ...29 „ein wechselseitiges Hören bei dem jeder (!) etwas zu lernen hat. Das gläubige Gottesvolk, das Kollegium der Bischöfe, der Bischof von Rom: der eine hört auf den anderen, und gemeinsam hören sie auf den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit (Joh 14,17), um das zu erkennen, was Er seinen Kirchen sagt (Apg 2,7).“ 102
In Zukunft gilt es vom Hören ausgehend die Vielfalt synodaler Formen (wieder) zu entdecken und zu praktizieren, auch und gerade dort, wo es um gesamtpastorale Prozesse im Sinne einer „partizipativen“ Kirchenentwicklung geht.
9. SCHLUSSWORT
„Verantwortung teilen“ ist der Titel für eine Entwicklung, die noch längst nicht an ein Ende gekommen ist. Mit dem Projekt wurde eine Lernplattform geschaffen, die es weiter zu vernetzen und zu bespielen gilt. Notwendig wäre die Selbstrelativierung durch die stärkere Einbindung in ein „Netz pastoraler Orte“, zu deren Knotenpunkten all jene Orte gehören, „an denen Prozesse der kreativen Konfrontation von Evangelium und Existenz stattfinden“ 103, von denen gelernt werden kann. Das Thema „Partizipation“ ist auch in Zukunft vor einer Verengung auf eine aufgrund des „Priestermangels“ notwendig gewordene Aufgabenteilhabe durch freiwillig Engagierte zu schützen.
Es geht bei der Frage nach Partizipation durch freiwillig Engagierte nicht darum, neue Experten auszubilden, die das überkommene und in die Krise geratene System einfach weiterführen. Das Thema Partizipation ist von bestimmten Logiken freizuhalten, wie etwa der Logik der Versorgung der einen durch die anderen, der Logik der Aufgabenverpflichtung, der Rekrutierung und der Mitgliedschaft im Sinne der institutionellen Eingliederung von „brauchbaren“ Fähigkeiten. Gleichsam hat auch die Organisation von Bildungsprozessen der Versuchung erneuter Dichotomisierungen zwischen „Hauptamtlichen“ und „Ehrenamtlichen“, zwischen „Lehrenden“ und „Lernenden“, zwischen „Experten“ und „Nicht-Experten“ zu widerstehen. Partizipation ist als Ausgangspunkt und nicht nur als (zu vermittelnder) Gegenstand ernst zu nehmen. Anstatt Partizipation strukturell zu verharmlosen, ist ehrlich auf bestehende „Differenzen zwischen Semantik und Systemstruktur“ hinzuweisen. Außerdem gilt: Je höher die Tendenz ist, im „Eigenen“ zu verharren, umso dringlicher sind Lernprozesse zu organisieren, die vom „Anderen“ ausgehen.
Neu zu entdecken ist auch das Prinzip der Gegenseitigkeit und eine Teamkultur, die aus mehr besteht als die Summe von Einzelverantwortungen. Partizipative Prozesse in der Kirche springen unterdessen zu kurz, wenn das Interesse nicht dem Leben von Menschen in der Perspektive der Frohen Botschaft gilt. Um was es geht, ist die Identität von Christinnen und Christen und darum, dass sie am Leben der Menschen von heute „dran“ bleiben und gemeinsam die erneuernde Kraft des Evangeliums – „Leben in Fülle“ (Joh 10,10) – erfahren.
Mehr denn je braucht es dazu Orte des Hörens und des offenen und ehrlichen Dialogs. Bucher erklärt die „Ehrlichkeit in einer strukturell nicht sehr ehrlichen, weil immer noch recht vermachteten kommunikativen kirchlichen Kultur […] [, zu] eine[r] Überlebensfrage der Kirche“ 104schlechthin.
Darin könnte auch die Chance des Projekts „Verantwortung teilen“ liegen: Räume offen zu halten, in denen auf dialogische und ehrliche Weise gelernt und entdeckt wird, was es heißt, auf partizipative und relevante Weise Christin und Christ in der Welt von heute zu sein.
1SPIELBERG, Bernhard: Lokal, lustvoll, lebensnah. Pfarrgemeinderäte zwischen Herein- und Herausforderungen, in: LANDESKOMITTEE DER KATHOLIKEN IN BAYERN: Handbuch Pfarrgemeinderat, Freiburg/Br. u. a. 2012, S. 74-80, hier S. 74.
2Ebd. [Hervorhebung E. K.]
3Vgl. SELLMANN, Matthias: Zuhören, Austauschen, Vorschlagen. Entdeckungen pastoraltheologischer Milieuforschung, Würzburg 2012, bes. S. 147-254. Vgl. EBERTZ, Michael N.: Anschlüsse gesucht. Ergebnisse einer neuen Milieu-Studie zu den Katholiken in Deutschland, in: Herder Korrespondenz 60 (4/ 2006), S. 173-177. Spielberg spricht in diesem Zusammenhang von der sogenannten „Exkulturation“, das heißt der „wachsende[n] Distanz zwischen der kirchlichen Praxis einerseits und dem Leben eines großen Teils der Menschen andererseits“. SPIELBERG, Lokal, lustvoll, lebensnah, S. 74.
4EBERTZ, Michael N.: Kirche im Gegenwind. Zum Umbruch der religiösen Landschaft, Freiburg/Br. u. a. 1997, S. 135.
5BUCHER, Rainer: Die Provokation annehmen. Welche Konsequenzen sind aus der Sinusstudie zu ziehen?, in: Herder Korrespondenz 62 (6/ 2008), S. 450-454, hier S. 454.
6Aus guten Gründen wird hier auf den Begriff des „Ehrenamtes“ verzichtet. Pointiert schreibt Bucher: „Zukunftsweisender Umgang mit ‚Ehrenamtlichen‘ setzt voraus, sie gerade nicht primär als ‚Ehrenamtliche‘ zu adressieren, wahrzunehmen und zu behandeln, vielmehr als erfahrungsreiche Mitchristinnen und Mitchristen, die unter Umständen bereit sind, unentlohnt und im öffentlichen Rahmen zu tun, wofür es Kirche gibt: das Evangelium und unsere heutige Existenz kreativ in Spiel zu bringen, in Wort und Tat, hier und heute, im Kleinen und im Großen, zum Segen für andere und für sich selbst. Mit anderen Worten, die bereit sind, öffentlich pastoral tätig zu sein.“ BUCHER, Rainer: … wenn nichts bleibt, wie es war. Zur prekären Zukunft der katholischen Kirche, Würzburg 22012, S. 130.
7Vgl. ELLEBRACHT, Heiner/LENZ, Gerhard/OSTERHOLD, Gisela: Systemische Organisations- und Unternehmensberatung. Praxishandbuch für Berater und Führungskräfte, Wiesbaden 42001, S. 149f.
8BISTUM AACHEN (Hg.): Satzung für den Rat der Gemeinschaft der Gemeinden (GdG-Rat), 2013, § 3,1. Abrufbar unter: http://gemeindearbeit.kibac.de/medien/bb1be98f-a608-45c7-8f10-861d4f65bfd4/1.broschuere-satzung.web.pdf[Zugriff: 24.04.2016].
9Ebd.
10Ebd. § 3,3.
11Vgl. ebd.
12FUCHS, Ottmar: Die Kirchen vor der missionarischen Herausforderung durch HIV/AIDS – theologische Reflexionen, in: Francis X. D‘ SA/Jürgen LOHMAYER: Heil und Befreiung in Afrika, Würzburg 2007, S. 184-202, hier S. 193.
13Vgl. ebd.
14Vgl. BÖHNKE, Michael: ‚Gemeindeleitung‘ durch Laien. Genese und Ergebnisse eines Forschungsprojektes, in: DERS./Thomas SCHÜLLER (Hg.): Gemeindeleitung durch Laien? Internationale Erfahrungen und Erkenntnisse, Regensburg 2011, S. 9-33, hier S. 12-14.
15Vgl. KRÖGER, Elisa: (Weiter-)Bildungsbedarfe aus der Perspektive freiwillig Engagierter in Leitungsteams in der Diözese Aachen – eine empirische Untersuchung“, in diesem Band, S. 125-168.
16BUCHER, … wenn nichts bleibt, S. 134.
17BUCHER, Rainer: Aufmerksamkeit, Demut und Ermutigung durch Vertrauen. Charisma und Leitung – ein Spannungsfeld, in: Unsere Seelsorge (September 2011), S. 8-11, hier S. 9, verfügbar unter: http://www.bistum-muenster.de/downloads/Seelsorge/2015/US_sep2015.pdf[Zugriff: 20.04.2016].
18Vgl. http://www.zap-bochum.de/ZAP/die-methode.php[Zugriff: 19.04.2016]. Vgl. zur wissenschaftstheoretischen Diskussion die Beiträge in PthI 35 (2015/2). Vgl. auch SELLMANN, Matthias: Zuhören, Austauschen, Vorschlagen. Entdeckungen pastoraltheologischer Milieuforschung, Würzburg 2012.
19Vgl. die Ansprache von Papst Franziskus „Synodalität für das 3. Jahrtausend“ vom 17.10.2015, verfügbar unter: http://de.radiovaticana.va/news/2015/10/17/papstansprache_synodalit%C3%A4t_f%C3%BCr_das_3_jahrtausend/1180030[Zugriff: 20.04.2016]. Dort heißt es: „Die Synodalität als konstitutives Element der Kirche bietet uns einen angemesseneren Interpretationsrahmen für das Verständnis des hierarchischen Dienstes. Wenn wir verstehen, dass wie der heilige Johannes Chrysostomos sagt ‚Kirche und Synode Synonyme sind‘ (Explicatio in Ps 149) – weil die Kirche nichts anderes ist als das gemeinsame Gehen der Herde Gottes auf den Wegen der Geschichte zur Begegnung mit Christus dem Herrn – dann verstehen wir auch, dass in ihrem Inneren niemand über die anderen ‚erhoben’ ist. Im Gegenteil, in der Kirche ist es notwendig, dass sich jemand ‚erniedrigt‘, um sich in den Dienst an den Geschwistern auf dem Weg zu stellen.“
Читать дальше