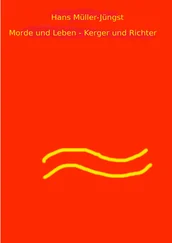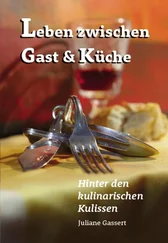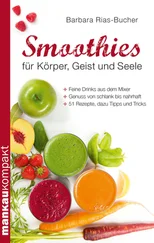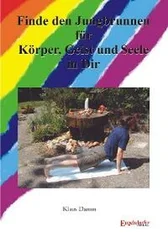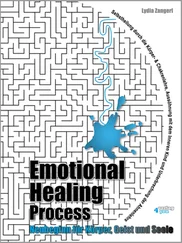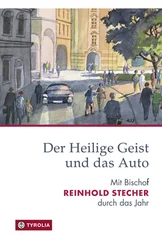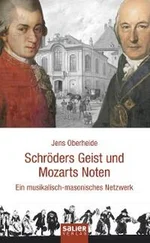Herausforderungen der Diaspora
Die Christ(inn)en der Diaspora sind als Minderheit „zwischendrin“, in ständigem Alltagskontakt mit „Anderen“: Familienmitgliedern, Nachbar(inne)n, Berufskolleg(inn)en, städtischen Institutionen. Diese Begegnung, keineswegs immer solidarisch und friedlich, fordert heraus: Was tun bei machtförmiger Konfrontation? Welche Außenwirkung soll angezielt werden? Wie weit reicht die gemeinsame Basis mit den „Anderen“? Die christliche Briefliteratur zeigt mehrschichtige Antworten – exemplarisch seien hier die sog. Sendschreiben Offb 2f., Röm 12 und 1 Petr angeführt: Texte, in denen Ethos anschaulich verhandelt wird.
Wo sind „wir“ anders? Ein Grenzdiskurs
Ganz praktisch treibt die ersten Christ(inn)en eine Konsum-Frage um: 8Die Stadt feiert auf den Straßen mit einer festlichen Prozession, anschließend werden die geopferten Rinder gebraten. Seltener kostenloser Fleischgenuss lockt: zugreifen oder ablehnen, verzichten und auffallen? Die Geschäftsfreunde laden ein, die Kolleg(inn)en treffen sich, die Delikatesse des Abends ist ein Braten – Fleisch aus einer heidnischen Opferzeremonie: vor allen Farbe bekennen, auf keinen Fall mit „den Götzen“ in Kontakt treten? Oder den ganzen Götzenkult für Humbug halten, im Stillen dem Schöpfer danken und zugreifen? Ist Götzenopferfleisch mit dem Christsein vereinbar?
Ein rigoroses „Nein“ kommt von den sog. Sendschreiben an die Gemeinden in Pergamon und Thyatira, Kleinasien (Offb 2,12–17.18–29; vgl. auch die Ablehnung der „Nikolaiten“ in Ephesus in Offb 2,6). Sie polemisieren gegen die falsche Lehre eines „Balaam“ bzw. der „Nikolaiten“ (2,6.14.15) und einer Prophetin „Izeabel“ (2,20). 9Die ist fix auf den Punkt gebracht: „Götzenopferfleisch essen“ und „huren“ (2,14.20) 10. Ohne jegliche Interessen an deren theologischen Gründen werden die Träger(innen) dieser Position demontiert, der Kompromiss mit dem Mainstream abgelehnt.
Warum so rigoros? Die Sendschreiben ziehen eine akute Bedrohungskulisse auf. Ephesus hat Unbestimmtes „getragen wegen meines Namens“ (2,3); Mitgliedern der „bettelarmen“ und damit ohnehin marginalisierten Gemeinde in Smyrna (2,9) steht „Leid“, konkret ein Gefängnisaufenthalt und damit de facto ein Konflikt mit politischen Institutionen bevor (2,10) – mit möglicher Todesfolge (2,10f.). Die Gemeinde in Pergamon blickt schließlich auf die Tötung des „treuen Zeugen“ Antipas zurück (2,13). Die „Überwinder“-Sprüche am Ende jedes Sendschreibens sprechen die Sprache des Kampfes – Kräftemessen, Entmachtungsversuche, Verletzung. Auch wenn die Verursacher der Repressalien nicht beim Namen genannt werden, so stehen die Zeichen auf Abgrenzung von einer als feindselig empfundenen Umgebung. Überall, wo die Sendschreiben gelesen werden, stützt die Inszenierung eines Kaiser- und Götterkults das Imperium, die Stadtgemeinschaft, den Mainstream, die aktuellen Machthaber – für die Sendschreiben mit ihrer Erfahrung von Bedrängnis und Martyrium eine mythologisch eingedunkelte („Satan“) Machtsphäre. Sich mit ihr zu kompromittieren hieße in den Augen der Sendschreiben, sie zu verharmlosen, sich um ein Stück Fleisch an sie zu „verkaufen“ – v.a. aber, an der Grundfeste des Monotheismus zu rütteln.
Auch andere Protagonisten des Urchristentums lehnen den Genuss von Opferfleisch ab, stimmen also in der Sache überein – kommunizieren dies aber in ganz anderem Stil: Die Apostelgeschichte inszeniert eine entsprechende Auflage an Heid(inn)en als Weisung „von oben“, von einem Jerusalemer Leitungsgremium, die per Brief dekretiert wird (Apg 15,28f.). Den anspruchsvollsten Weg wählt sicher Paulus: Im (brieflichen) Dialog (vgl. 1 Kor 8–10) 11stellt er sich den Gegenargumenten – und versucht, zu überzeugen. Nicht zuletzt wirft er die Rücksicht auf die Anfechtungen des „schwachen“ Bruders in die Waagschale (1 Kor 8,1–13).
Alltägliche „Außenwirkungen“
Kontakt mit anderen Göttern ist also für Christ(inn)en tabu – doch was tun im viel weiteren Kontakt mit den „Anderen“ außerhalb der Mahlsituationen? Hier geben 1 Petr und Röm 12 Auskunft, auch aus einer Minderheits- und Unterdrückungserfahrung heraus (z.B. Röm 8,31–39; 1 Petr 2,11; 3,14–16; 4,14–16).
Die Christ(inn)en des 1 Petr haben ihr Leben neu ausgerichtet- und die „Anderen“ in ihrer Umgebungskultur hinter sich gelassen. Sie haben sich damit verbessert, wird doch das Frühere als „unnütz“ und „Unkenntnis“ deklariert (1,14.18). Die Innovation verdankt sich allerdings der Initiative Gottes. Aller neuer Lebenswandel reagiert auf die Erwählung, die Vorleistung Gottes: kein Grund zur Überheblichkeit ggü. denen, die den „alten“ Lebensstil beibehalten haben (1,14–2,10).
Von außen schlagen den Angesprochenen nun Verbalinjurien, Kriminalisierung und „Leiden“ entgegen. 1 Petr empfiehlt, darauf mit demonstrativ „guter“ Praxis zu reagieren: Der geforderte Abstand zu „fleischlichen Begierden“, so 1 Petr 2,11 summarisch, ist ein ethischer Topos der Umgebungskultur, in der Philosophie und Lebenskunst die menschliche Selbstkontrolle idealisieren. Ein gemeinsames Verständnis von moralisch gutem Leben ist notwendig, wenn sich 1 Petr nicht nur die Widerlegung der Verleumdung von außen erhofft (2,12; 3,16), sondern sogar damit rechnet, dass die Anderen aufgrund von Beobachtung den Gott der Christ(inn)en anerkennen werden (1 Petr 2,12; vgl. 3,1). Was ausstrahlt, sind ein harmonischer und loyaler Umgang miteinander; 12Mitleid und Demut 13– und der Ausstieg aus einem Vergeltungskreislauf (3,8f.), wie er sich bereits in jesuanischer Tradition findet (Mt 5,39–41.44f.; Lk 6,27–29). Darüber hinaus gilt es für die Christ(inn)en, sich dort unterzuordnen, wo – weit entfernt von Gleichheit der Person oder demokratischer Meinungsbildung – gesellschaftliche Übermacht herrscht: im Staat, im Haus (1 Petr 2,13–3,7). Wenn gefordert, sollen die Christ(inn)en auch zu einem verteidigenden „Wort von der Hoffnung“ greifen, doch dies im Stil von „Milde“, „Furcht“, mit „gutem Gewissen“, wiederum also in Bescheidenheit (1 Petr 3,15f.).
Die Analogien zu diesen Weisungen für Außenbeziehungen in Röm 12 sind, auch bei unterschiedlichen Akzenten, erstaunlich: „(9) … das Böse verabscheuend, am Guten hängend (vgl. 1 Petr 2,12; 3,11) … (12) in der Hoffnung euch freuend, in der Bedrängnis euch geduldend (vgl. 1 Petr 2,20) … (14) Segnet, die euch verfolgen, segnet, und verflucht nicht … (17) keinem Schlechtes für Schlechtes zurückgebend (vgl. 1 Petr 3,9), das Gute vordenkend vor allen Menschen. (18) Wenn es von euch aus möglich ist, mit allen Menschen in Frieden lebend (vgl. 1 Petr 3,11), (19) nicht euch selbst verteidigend – sondern gebt dem Zorn Raum, geschrieben ist nämlich: Mir gehört die Rache, ich werde vergelten, spricht der Herr (vgl. 1 Petr 2,23; 3,12). (20) Sondern: Wenn dein Feind hungert, mache ihn satt; wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Wenn du nämlich das tust, wirst du Feuerkohlen auf seinen Kopf häufen. (21) Werde nicht vom Schlechten besiegt, sondern besiege mit dem Guten das Schlechte.“ (vgl. 1 Petr 3,13) 14Es scheint, als hätte sich der Weg der demonstrativen Güte und Zurückgenommenheit im Umgang mit „den Anderen“ bewährt.
Auf Kurs bleiben: Christliche „Fernbeziehungen“ 15
Was die Binnenbeziehungen angeht, gilt den Christ(inn)en auf der Face-to-Face-Ebene vor Ort das (kulturell etablierte) Ideal der Einmütigkeit – doch wie bleiben die verstreuten Grüppchen untereinander in Kontakt, geschweige denn Teil eines gemeinsamen Ganzen?
Erstes Mittel der Wahl sind – und das mag angesichts der Schwierigkeiten einer antiken Reise erstaunen – persönliche Begegnungen. Nicht nur die Missionare(n) wie Paulus und seine Mitarbeiter(innen) oder Petrus, die Brüder des Herrn und die übrigen Apostel (vgl. 1 Kor 9,5) reisen auf den Land- und Seewegen zwischen Palästina und Italien. Paulus hört durch die „Leute der Chloe“ vom Streit in Korinth (1 Kor 1,11); Stephanas, Fortunatus und Achaikus, wohnhaft in Korinth, besuchen Paulus in Ephesus (1 Kor 16,17); Paulus gibt Phoebe aus Kenchreae wohl seinen Brief nach Rom mit (Röm 16,1f.). Mit Selbstverständlichkeit hören wir bei Paulus von hoher Mobilität. Paradebeispiel ist das Ehepaar Priska und Aquila, ursprünglich aus Rom, von dort nach Korinth ausgewiesen (Apg 18,2), mit Paulus nach Ephesus übersiedelt (1 Kor 16,19), und wahrscheinlich wieder nach Rom zurückgekehrt (Röm 16,3–5). Den Reisenden bieten gerade die christlichen Schwestern und Brüder eine unkomplizierte Anlaufstelle in der fremden Großstadt. Wieder und wieder wünscht sich auch Paulus, persönlich zu kommen (z.B. Röm 15,22–24; 1 Kor 16,5–7). Ist das nicht möglich, dienen Briefe als nicht ganz adäquater Ersatz – die Dichte einer Face-to-face-Kommunikation können sie nicht erreichen.
Читать дальше