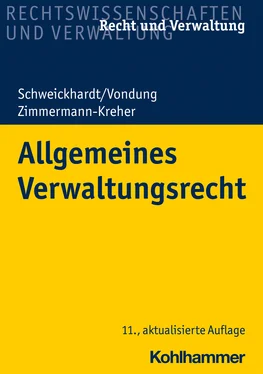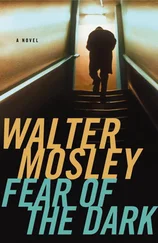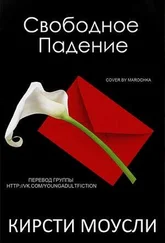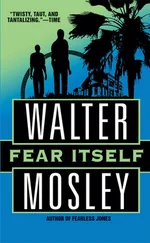57Dieses Nebeneinander von öffentlichem und privatem Recht kennzeichnet auch alle anderen sog. privatrechtsgestaltenden VA(= Maßnahmen aufgrund öffentlichen Rechtes zur Regelung privatrechtlicher Rechtsverhältnisse; Rn. 220).
Beispiel:Durch Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach §§ 24 f. BauGB „durch VA“ (§ 28 II BauGB) wird die Gemeinde Vertragspartnerin eines (privatrechtlichen) Kaufvertrages nach § 433 BGB.
B.Quellen des Verwaltungsrechts
I.Begriff und Bedeutung
58Art. 20 III GG bindet die öffentliche Verwaltung als Teil der „vollziehenden Gewalt“ an „Gesetz und Recht“. Was in diesem Sinne rechtlich bindend ist, ergibt sich aus einzelnen Rechtsnormen ,die wiederum ihren Entstehungsgrundin bestimmten Rechtsquellenhaben.
Beispiele:Jeder, der sich nicht selbst ernähren kann, hat grundsätzlich einen Anspruch auf staatliche Leistungen. Dieses Recht auf Gewährleistung des Existenzminimums ergibt sich z. B. aus Rechtsnormen des SGB II, SGB XII und des AsylbLG, also formellen Gesetzen. Ohne diese Rechtsquellen würde sich das Recht direkt aus dem Grundgesetz (Art. 1 I, 2 I i. V. m. dem Sozialstaatsprinzip in Art. 20 I GG), also aus dem Verfassungsrecht als Rechtsquelle ergeben.
Dass jeder Einwohner einer Gemeinde ein Recht auf gleichen Zugang zu Einrichtungen der Gemeinde hat, ergibt sich aus dem formellen Gesetz Gemeindeordnung (§ 10 II GemO); es kann sich aber auch unmittelbar aus einer für die Benutzung der Einrichtung erlassenen Satzung ergeben.
Rechtsnormen sind i. d. R. abstrakt-generelle, d. h. für eine unbestimmte Vielzahl von Situationen und betroffene Personen geltende Regelungen, die Pflichten und Rechte für die Bürger oder sonstige selbstständige Rechtspersonen begründen, ändern oder aufheben, also nicht reines Innenrecht der Träger öffentlicher Verwaltung und ihrer Behörden darstellen.
II.Die geschriebenen Rechtsquellen
1.Normenhierarchie
59Die – auch zahlenmäßig – wichtigsten Rechtsquellen des heutigen Verwaltungsrechts sind aus Rechtsetzungsakten mit einem festgelegten förmlichen Verfahren hervorgegangen, an dessen Ende die schriftliche Fixierung (z. B. die Ausfertigung von Landesgesetzen nach Art. 63 I S. 1 Verf.BW) steht. Man bezeichnet sie deshalb auch als geschriebene Rechtsquellen.
60Die Einteilung erfolgt nach dem Normgeber und hält sinnvollerweise eine bestimmte Rangfolgeein, die sich aus dem Verhältnis der Rechtsnormen zueinander ergibt (Normenhierarchie). Die notwendige Widerspruchsfreiheit der Rechtsordnung verlangt, dass klar ist, welche Norm Geltungsvorrangvor der anderen hat. Vorrang bedeutet, dass im Kollisionsfall die höherrangige Norm gilt, die nachrangige damit rechtswidrig und unbeachtlich (nichtig) ist.
Umgekehrt haben die nachrangigen Rechtsnormen regelmäßig Anwendungsvorrang,das bedeutet, dass sie, soweit sie speziellere Regelungen als die höherrangigen Rechtsnormen enthalten, diesen in der Anwendung vorgehen, die höherrangigen also nur subsidiär gelten.
So verdrängen in den o. g. Beispielen (Rn. 58) die Rechtsnormen des SGB II und des SGB XII die dem Grundgesetz zu entnehmenden Rechtsgrundlagen auf Sicherung des Existenzminimums; eine die Benutzung einer Gemeindeeinrichtung regelnde Satzung verdrängt die Rechtsgrundlage des § 10 II GemO.
61Dem höherrangigen Recht ist jeweils im Einzelnen zu entnehmen, welchen formellen und materiellen Rechtmäßigkeitsvoraussetzungendie nachrangige Rechtsnorm genügen muss.
Formell rechtmäßigist eine Rechtsnorm des geschriebenen Rechtes nur, wenn die erlassende Stelle hierfür zuständig ist. Bei formellen Gesetzen ist das vor allem eine Frage der Verteilung der Gesetzgebungskompetenz zwischen Bund und Ländern durch das Grundgesetz (Art. 70 ff.); bei nachrangigen Rechtsnormen regeln formelle Gesetze (wiederum unter Beachtung verfassungsrechtlicher Vorgaben, z. B. der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie in Art. 28 II GG), wer hierfür zuständig ist. Ähnliches gilt für die dem Verfassungsrecht zu entnehmenden Vorschriften für das formelle Gesetzgebungsverfahren (Art. 76 ff. GG; Art. 59 ff. Verf.BW) bzw. die in den entsprechenden formellen Gesetzen enthaltenen Verfahrensvorschriften für nachrangige Rechtsnormen (z. B. in § 4 GemO für Satzungen der Gemeinde, in §§ 17, 18 PolG für Polizeiverordnungen) einschließlich der bei allen Rechtsnormen erforderlichen Ausfertigung und Verkündung.
Die materielle Rechtmäßigkeitformeller Gesetze hängt vor allem von der Beachtung der Grundrechte und der für sie geltenden Schrankenbestimmungen des Grundgesetzes ab; die der nachrangigen Rechtsnormen von der Einhaltung des Ermächtigungsrahmens, jeweils unter Berücksichtigung der Grundsätze der Bestimmtheit, des Vertrauensschutzes und der Verhältnismäßigkeit.
2.Prüfungs- und Verwerfungskompetenz
62Die Erkenntnis, eine nachrangige Rechtsnorm verstoße gegen eine höherrangige, erlaubt noch nicht die Schlussfolgerung, dass der rechtsanwendende Behördenbedienstete oder auch ein überprüfendes Gericht diese Norm ohne Weiteres unbeachtet lassen darf.
Unzweifelhaft ergibt sich aus der Gesetzesgebundenheitder Verwaltung, dass sich jeder Behördenbedienstetezunächst Klarheit darüber verschaffen muss, ob die im konkreten Falle anzuwendende Rechtsnorm mit höherrangigem Recht im Einklang steht. Bei formellen Gesetzen hat er dabei von einer (widerleglichen) Vermutung auszugehen, dass dies so ist. Die Widerlegung dieser Vermutung ist ausschließlich Sache des Bundes- bzw. des Landesverfassungsgerichtes, die allein dazu befugt sind, das Grundgesetz bzw. die Landesverfassung authentisch zu interpretieren. Im Falle von Zweifeln muss er sich an seine Vorgesetzten bzw. nächsthöhere Behörden wenden, um auf diese Weise schließlich eine Normenkontrolle nach Art. 93 I Nr. 2 GG durch das Bundesverfassungsgericht bzw. nach Art. 68 I S. 2 Nr. 2 Verf.BW durch den Verfassungsgerichtshof zu erreichen, da hierzu erst die Regierung antragsbefugt ist. In Fällen, in denen schnell entschieden werden muss, wird man dem einzelnen Behördenbediensteten das Recht zubilligen müssen, eine Rechtsnorm nach möglichst sorgfältiger Prüfung (d. h. nach Ausschöpfung aller zu Gebote stehenden Erkenntnismöglichkeiten) unangewendet zu lassen und entsprechend zu entscheiden.
63Bei Normen im Range unter dem formellen Landesgesetz eröffnet § 47 I S. 2 VwGO die Möglichkeit, dass Behörden diese Rechtsvorschriften im Rahmen einer sog. prinzipalen Normenkontrolle(s. Rn. 1036) durch das zuständige OVG, in Baden-Württemberg also den VGH in Mannheim, überprüfen lassen und solange das Verfahren aussetzen.
Nach der Rechtsprechungdes BVerwG (BVerwGE 75, 142) sind Behörden nicht befugt, die Nichtigkeit eines rechtswidrigen Bebauungsplanes allgemein verbindlich festzustellen. Die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen eine Behörde, die einen Bebauungsplan für unwirksam hält, befugt ist, bei ihren Entscheidungen von seiner Nichtigkeit auszugehen, wurde vom BVerwG ausdrücklich nicht grundsätzlich entschieden (BVerwGE 112, 373, 380). Nach Auffassung des BGH (NVwZ 1987, 168, 169) handeln aber die Bediensteten einer Baugenehmigungsbehörde amtspflichtwidrig, wenn sie einen nichtigen Bebauungsplan anwenden. Der VGH BW hat in einem nicht veröffentlichten Beschluss (vom 28.1.1991 – 8 S 2238/90 –) festgestellt, es sei „unstreitig, dass die Baugenehmigungsbehörde ebenso wie das Verwaltungsgericht bei der Entscheidung über die Zulässigkeit eines Vorhabens überprüfen kann und muss, ob der dem Vorhaben zugrunde liegende Plan (Anm.: gemeint ist der Bebauungsplan) rechtsgültig ist oder nicht, und dass sie, wenn sie zur Annahme der Nichtigkeit gelangt, diesen bei ihrer Entscheidung unberücksichtigt zu lassen hat.“ Aus Gründen der Rechtssicherheit wird man eine solche inzidente Verwerfungskompetenz der Verwaltung jedoch (wie bei formellen Gesetzen) auf Eilfälle beschränken müssen und im Übrigen davon ausgehen müssen, dass der Normenkontrollantrag bei Aussetzung des Verfahrens die einzige Möglichkeit ist, die Feststellung der Nichtigkeit zu erreichen, soweit nicht der zuständige Normgeber (bei Bebauungsplänen die Gemeinde) die Norm selbst aufhebt.
Читать дальше