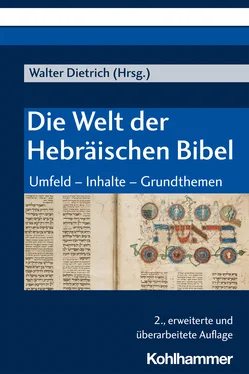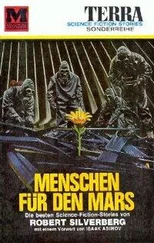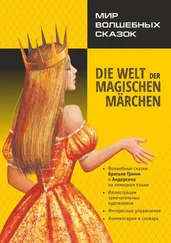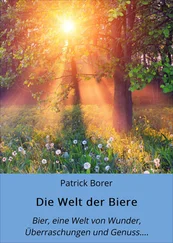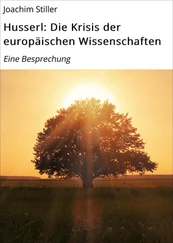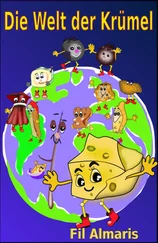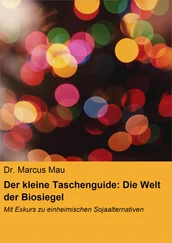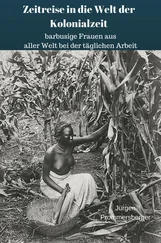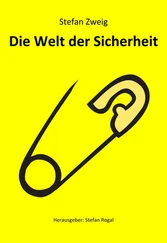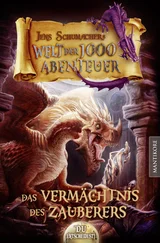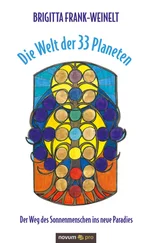5. Epochen der Literaturgeschichte der Hebräischen Bibel
Wie ist die Literaturgeschichte der Hebräischen Bibel zu gliedern? Epochengliederungen beruhen zwangsläufig auf von außen an die Literatur des antiken Israel herangetragenen Kategorien.
Dass es Epochen der biblischen Literatur gegeben hat, die einen vergleichbaren geistigen Orientierungsrahmen zeigen, sollte nicht in Frage gestellt werden. Dies lässt sich vor allem daran beobachten, dass mit dem Erlangen eines gewissen Grades von Staatlichkeit der politischen Gebilde Israel und Juda im 9. und 8. Jh. v. Chr. diese jungen Staaten sogleich in den Einflussbereich der Hegemonialmächte in Mesopotamien, aber auch in Ägypten gerieten, der sie kultur- und literaturgeschichtlich maßgeblich bestimmte. So ist es wohl kein Zufall, dass zwei der wichtigsten theologischen Literaturwerke im Pentateuch – das Deuteronomium und die Priesterschrift – in unverkennbarer Weise in Reaktion auf entsprechende zeitgenössische imperiale Konzeptionen gestaltet worden sind: das Deuteronomium als subversive Rezeption neuassyrischer Vertragstheologie, 10die Priesterschrift in modifizierender Aufnahme persischer Reichsideologie. 11
Die Einteilung der Literaturgeschichte der Hebräischen Bibel nach den jeweiligen imperialen Großmächten und ihren ideologischen und kulturgeschichtlichen Einflüssen ist in historischer Hinsicht naheliegend, ihr kommt aber nur ein relatives Recht zu. Die Literaturgeschichte des antiken Israel bietet darüber hinaus auch Anhaltspunkte zu einer endogenen Gliederung, die ebenfalls zu beachten sind. Man braucht nur an die von Gunkel vorgeschlagene Periodisierung zu denken, die trotz ihres hohen forschungsgeschichtlichen Alters – jedenfalls was die historische Ansetzung der literaturgeschichtlichen Hauptzäsuren betrifft – nach wie vor überraschend aktuell ist: Gunkel unterschied im Wesentlichen drei Epochen in der Literatur des antiken Israel: zunächst diejenige der Volksüberlieferungen (bis ca. 750 v. Chr.), dann diejenige der großen Einzelschriftsteller (zwischen ca. 750 und 540 v. Chr.) und dann diejenige der Epigonen. Heute setzt man nicht mehr die großen Autoren von ihren Epigonen ab, zumal das zu Gunkels Zeiten den großen Autoren zugeschriebene Textgut durch die literaturgeschichtliche Analyse der Hebräischen Bibel erheblich geringer geworden ist. Bedenkenswert bleibt jedoch die Ansetzung der Gliederungseinschnitte: Sie betreffen zunächst das ausgehende 8. Jh. v. Chr., dem mit dem Untergang des Nordreichs erhebliche überlieferungsbildende Funktion zukommt, was zum einen die prophetische Tradition betrifft, in der nun die Unheilsprophetie als schriftliche Größe wenngleich wohl nicht erst entsteht, 12so doch zumindest stark akzentuiert wird, zum anderen aber auch für die drei großen Überlieferungskerne der erzählenden Bücher der Hebräischen Bibel im Bereich Gen – 2Kön gilt, die in den Väter-, Exodus- und Davidserzählungen zu finden sind. In all diesen Bereichen ist zwar noch älteres Textgut – wahrscheinlich auch mit mündlichen Vorstufen – verarbeitet worden. Die theologisch interpretierende Fixierung der Gründungslegenden für ganz Israel ist am ehesten jedoch nach dem Untergang des Nordreichs denkbar. 13Für die Ursprungslegenden der Väter- und Exoduserzählung liegt dies – neben allgemeinen kulturgeschichtlichen Überlegungen zum Aufkommen der Schriftkultur im antiken Israel – aufgrund ihrer nichtköniglichen Ausrichtung ohnehin auf der Hand. Für die Davidserzählungen lässt es sich aufgrund der eigentümlichen Betonung Davids als König von ganz Israel vermuten.
Ganz anders freilich als Gunkel wird man die Epoche der »Epigonen« einstufen müssen. Die alttestamentliche Wissenschaft des letzten Jahrhunderts hat zur Genüge deutlich gemacht, dass die genialischen Konzeptionen in den biblischen Büchern, die zu Gunkels Zeiten noch den großen Einzelschriftstellern der Königszeit zugewiesen wurden, zu erheblichen Anteilen den schriftgelehrten Tradenten der persischen und hellenistischen Zeit zugeschrieben werden müssen, die in vielen Fällen diese Einzelschriftsteller als implizite Autoren ihrer Bücher allererst konstruiert haben. Damit verbindet sich auch die Notwendigkeit einer Revision der im 19. Jahrhundert geläufigen und auch im 20. Jahrhundert noch nicht ganz aus der Übung geratenen Abwertung des nachexilischen »Judaismus« gegenüber dem vorexilischen »Hebraismus« 14, die sich weder historisch noch theologisch begründen lässt. 15
6. Die Datierbarkeit biblischer Texte
Literaturgeschichtliche Rekonstruktionen am Alten Testament gehen davon aus, dass dessen Texte – oder zumindest ein wichtiger Teil davon – datierbar sind. Da es keine Textzeugen der Hebräischen Bibel aus biblischer Zeit gibt (die Qumrantexte reichen für die jüngsten Bücher der Hebräischen Bibel, etwa das Danielbuch, bis auf wenige Jahrzehnte an den Zeitpunkt von deren literarischer Fertigstellung heran), ist man allein auf interne Beobachtungen angewiesen. Die Frage nach der Datierung biblischer Texte bleibt notorisch schwierig, ist oft nur in relativen Verhältnisbestimmungen vorzunehmen und lässt sich nur selten in klare absolute historische Einordnungen überführen, da die Texte selber über ihre Entstehungszeit entweder schweigen oder nur kritisch zu evaluierende Angaben darüber machen. Es lässt sich aber feststellen, dass sich die Sachlagen in den drei Teilen des hebräischen Bibelkanons unterschiedlich verhalten. Die historische Verortung biblischer Texte dürfte im Bereich der Prophetenbücher vergleichsweise am klarsten vorzunehmen zu sein. Das hängt damit zusammen, dass die Prophetenbücher am ehesten so etwas wie literaturgeschichtliche »Leitfossilien« 16zu erkennen geben, die sich aufgrund bestimmter politisch-theologischer Prägungen als solche sortieren lassen. So bieten etwa die Erwartung eines umfassenden kosmischen Weltgerichts, die Unterscheidung von Frevlern und Frommen, die Bevorzugung der Abkömmlinge der ersten Gola (der Deportation Jojachins und seiner Gefolgschaft 597 v. Chr.) gegenüber den damals im Land Verbliebenen oder die »deuteronomistische« Interpretation der Schuldgeschichte Israels recht klare Zuordnungsmerkmale prophetischer Texte zu bestimmten politischen oder sozialgeschichtlichen Problemlagen aus der Geschichte Israels und Judas: Die Vorstellung eines kosmischen Weltgerichts setzt den Zusammenbruch des weltumspannenden Perserreichs voraus, die Unterscheidung von Frevlern und Frommen die Aufkündigung der noch bis in die späte Perserzeit supponierten Einheit des Gottesvolks, die Favorisierung der Jojachin-Gola widerspiegelt Konflikte der frühpersischen Zeit zwischen Heimkehrern und im Land Verbliebenen und die »deuteronomistische« Geschichtstheologie gehört in die Zeit nach dem Untergang Judas und Jerusalems.
Anders verhält es sich im Bereich des Pentateuchs und der Geschichtsbücher. Sie sind zwar reich an geschichtlichen Aussagen. Aber diese gehören nicht in die Welt des Erzählten, sondern des Erzählers und bedienen deswegen in der Regel nicht das Interesse des historischen Zugriffs. Das gilt zwar auch für die prophetische Literatur, doch ist deren erzählte Welt nicht zusätzlich in die mythische Ursprungszeit Israels zurückversetzt. Eben aufgrund des Umstands, dass die erzählte Welt von Pentateuch und Geschichtsbüchern eine derart starke Eigenprägung mit sich bringt, versagen die an der prophetischen Literatur gewonnenen Instrumente zur historischen Einordnung der Texte mitunter. Die literaturgeschichtlichen »Leitfossilien« lassen sich aber hinter ihren mythischen Einkleidungen, die kritisch analysiert werden müssen, durchaus noch erkennen. Einen zentralen Datierungsanhaltspunkt im Pentateuch bietet zudem nach wie vor der aufgrund neuassyrischer Aufnahmen in die spätvorexilische Zeit datierbare Kern des Deuteronomiums. 17
Читать дальше