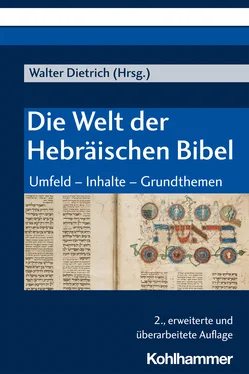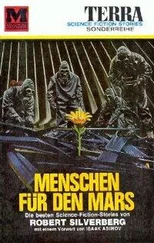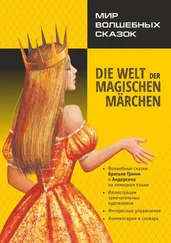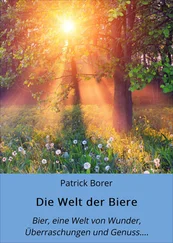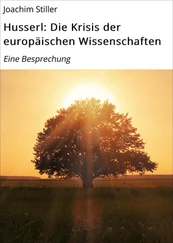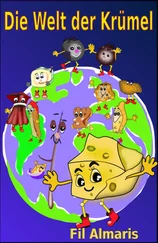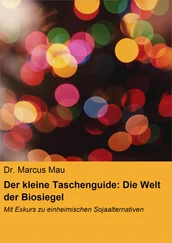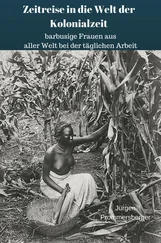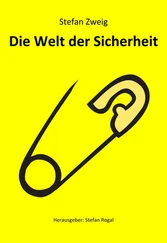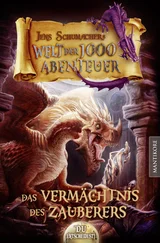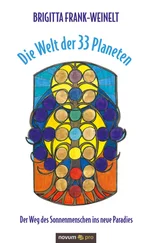Noch einmal andere Probleme stellen sich bei der historischen Interpretation der poetischen Bücher der Hebräischen Bibel, namentlich der Psalmen. Entsprechend ihren Gattung sind sie oft bewusst in überzeitlichen Formulierungen gestaltet worden, so dass hier absolute Datierungen in aller Regel überhaupt nur tentativ im Gefolge relativer Verhältnisbestimmungen zu anderen Teilen der biblischen Literatur möglich sind. In den Psalmen und in der Weisheitsliteratur finden sich allerdings hier und dort Hinweise auf einen sozialgeschichtlichen Hintergrund, der eine noch königszeitliche Entstehung bestimmter Textteile wahrscheinlich macht. 18
Bei allen Schwierigkeiten ist aber festzuhalten, dass das methodische Instrumentarium der alttestamentlichen Wissenschaft zur literaturgeschichtlichen Einordnung biblischer Texte stark ausdifferenziert ist – es gehört zu den großen Errungenschaften im Bereich von Textexegesen überhaupt. Allerdings ist immer wieder zu beobachten, wie bestimmte Teilschritte der Methodik gegenüber anderen unsachgemäß privilegiert werden, was zu Verzerrungen in der literaturgeschichtlichen Urteilsbildung führt. Die grundsätzlich unbestrittene Interdependenz der verschiedenen Methodenschritte stellt eine Maxime dar, die in der Exegese wieder neu einzufordern ist, wobei namentlich zwei Aspekte hervorzuheben sind: Zum einen ist es unabdingbar, dass entstehungsgeschichtliche Rekonstruktionen inhaltlich und sachlich begründet werden, und zum anderen müssen die Plausibilitäten der verschiedenen Schritte explizit und selbstkritisch gewichtet werden. Andernfalls droht der alttestamentlichen Exegese sowohl die Marginalisierung im Bereich der Theologie als auch in demjenigen der antiken Philologien.
In neuerer Zeit wird für die Literatur der Hebräischen Bibel vermehrt die Frage linguistischer Datierungsmöglichkeiten diskutiert, 19doch ist die methodische Diskussion dazu noch nicht ausgereift. Zwar ist die in der Sache seit Wilhelm Gesenius erkannte Unterscheidung zwischen dem »Classical Biblical Hebrew« in Genesis bis 2Könige sowie in den großen Prophetenbüchern und dem »Late Biblical Hebrew« im Rahmen von chronistischem Geschichtswerk, Ester und Daniel sprachgeschichtlich wichtig, doch liefert sie keine absoluten Datierungshinweise, da die Verwendung von »Classical Biblical Hebrew« in bestimmten Texten nicht nur von einer bestimmten Entstehungszeit abhängt, sondern auch von den gewählten Genres und theologischen Positionen.
7. Die Hebräische Bibel als sich selbst auslegende Traditionsliteratur
Die alttestamentliche Wissenschaft hat sich mehr und mehr der Einsicht geöffnet, dass die Hebräische Bibel nicht nur Text, sondern Text und Kommentar in einem ist, dass sie über weite Strecken hinweg durch Vorgänge innerbiblischer Schriftauslegung geprägt ist. 20Diese Einsicht hat die Einschätzung der Hebräischen Bibel insgesamt verändert: Sie gilt nicht mehr im Wesentlichen als kodifiziertes mündliches Gut, sondern als schriftgelehrte Traditionsliteratur, die in ihren Überlieferungskernen wohl auf eine mündliche Vorgeschichte zurückgehen mag, in der Substanz aber nunmehr als dichte, reflektierte Literatur anzusprechen ist. Diese Bestimmungen sind grundsätzlich auf alle drei Kanonsteile des hebräischen Alten Testaments anwendbar, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung im Blick auf deren einzelne Bücher.
Die zahlreichen Befunde von innerbiblischer Schriftauslegung verschärfen noch einmal die Notwendigkeit eines literaturgeschichtlichen Zugangs zum Alten Testament: Dessen Bücher und Texte verlangen nicht nur aufgrund des Umstandes, dass sie vergangenen Zeiten und entfernten Orten entstammen, eine historisch orientierte Auslegung, sondern sie sind eben in ansehnlichen Passagen gar nicht verständlich, wenn deren Auslegungsverhältnisse und Bezugnahmen zu anderen, vorgegebenen Texten nicht erkannt werden.
Umgekehrt führen die jeweiligen Vorgänge innerbiblischer Schriftauslegung auf literaturgeschichtlich relevante Beobachtungen, da diese Auslegungsprozesse in der Regel schriften- und zeitübergreifend ausgerichtet sind. Durch solche Bezugnahmen lässt sich erkennen, welche Texte auf welche reagieren, wie sie ihre Positionen zueinander in Beziehung setzen oder voneinander abgrenzen. Ein gutes Beispiel hierfür findet sich etwa in der kritischen Aufnahme von Jes 65–66 in Koh 1: Gegenüber den prophetischen Verheißungen eines neuen Himmels und einer neuen Erde hält Koh 1 fest, dass nichts Neues unter der Sonne zu erwarten sei, sondern dass die Menschen nach wie vor an die Lebensbedingungen der vorfindlichen Welt gewiesen seien, 21womit elementare Positionen der biblischen Urgeschichte (Gen 1–11) gegenüber Jes 65–66 bekräftigt werden. 22
8. Literaturgeschichte und Kanonsgeschichte
Besondere Beachtung verdient schließlich das Verhältnis von Literatur- und Kanonsgeschichte. Es liegen hinreichende historische Anhaltspunkte vor, damit zu rechnen, dass die biblische Literatur nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt per Dekret in einen kanonischen Status erhoben worden ist, sondern dass das Resultat der Kanonizität der Hebräischen Bibel auf einem langen Prozess beruht, der sich weitgehend ohne institutionell abgestützte Entscheidungen abgespielt hat. Literatur- und Kanonsgeschichte folgen einander also nicht nach, sondern überlappen sich: Die Kanonsgeschichte reicht weit in die Literaturgeschichte hinein, da den Texten der Hebräischen Bibel erst nach und nach zunehmende Autorität zugeschrieben worden ist, 23gleichzeitig erstreckt sie sich über die Literaturgeschichte hinaus: Kanon ist ein erst nachbiblisches Konzept.
Im Blick auf die neueren Forschungen zum hebräischen Bibelkanon sind vor allem zwei Erkenntnisse hervorzuheben, die als Rahmendaten für die weitere Diskussion zu respektieren sind. Zum einen ist v. a. mit der vollständigen Publikation der biblischen Texte aus Qumran 24deutlich geworden, dass der kanonische Abschluss der Hebräischen Bibel in der Zeit zwischen 100 v. und 68 n. Chr. nicht dergestalt zu deuten ist, dass von da an ein einheitlicher Textbestand vorgelegen hätte. 25Mit Erhard Blum gesprochen – bei ihm auf den Pentateuch bezogen – gibt es keine Endgestalt biblischer Texte, sondern nur verschiedene Textzeugen. 26Die Vorstellung eines kanonischen Textes im Sinne seiner buchstabengetreuen Fixierung ist erst nachalttestamentlich – sie hängt mit dem Aufkommen der Inspirationslehre zusammen und lässt sich erst gegen Ende des 1. nachchristlichen Jahrhunderts belegen (bes. deutlich in 4Esr 14 und bei Flavius Josephus, Contra Apionem I,8).
Damit zusammenhängend darf heute auch als gesichert gelten, dass die übliche Standardtheorie zum hebräischen Bibelkanon, die von einer grundsätzlichen Konkordanz der Dreiteilung der hebräischen Bibel in Tora, Propheten und Schriften mit der Kanonsgeschichte ausgeht, nicht mehr vertreten werden kann. Die drei Abteilungen des Kanons spiegeln nicht die drei Hauptphasen seiner Entstehung. 27Vielmehr sind zum einen Tora und Propheten als Kanonsteile in enger Interaktion zueinander entstanden, und zum anderen scheint die normative Schrift des Judentums um die Zeitenwende eine im Wesentlichen zweiteilige, und nicht dreiteilige Struktur gehabt zu haben, wie die zahlreichen Referenzen auf »die Tora (bzw. Mose) und die Propheten« in der zeitgenössischen Literatur zeigen. Eine feste Dreiteilung ist erst gegen Ende des 2. Jh.s n. Chr. bezeugt. Die Formierung eines eigenen Kanonteils »Schriften« scheint mit der Akzentuierung der besonders aus pharisäischer Perspektive wichtigen Alltagsrelevanz von Tora und Propheten zusammenzuhängen: Die »Schriften« erklären, wie man gesetzes- und schriftgemäß leben kann.
Der Weg zur Normativität der Schrift und schließlich zum Kanon ist durch zahlreiche Faktoren bestimmt. Zu ihnen zählen die Theologisierung des Rechts 28nach dem Untergang des Nordreichs und in deren Gefolge die bundestheologische Konzipierung des Deuteronomiums als einer unbedingt bindenden Urkunde eines Vertrags zwischen Gott und seinem Volk, Vorgänge der Übertragung kultischer Funktionen auf Texte im Nachgang zur Zerstörung des Jerusalemer Tempels, gewisse Rahmenbedingungen der persischen Religionspolitik, 29die schriftgelehrte Ausrichtung der Nicht-Tora-Texte an der Tora, der Entschluss zur paradigmatischen Abbildung verschiedener Literaturgattungen und andere mehr. Letztlich ist aber die Kanonsgeschichte nicht vollständig verstehbar, ohne dass man nach der theologischen Qualität der im Kanon versammelten Schriften fragt, die nicht zuletzt auch über deren Eigenschaft als mehrfach bereits im Verlauf ihrer biblischen Entstehung ausgelegte Texte beschreibbar ist.
Читать дальше