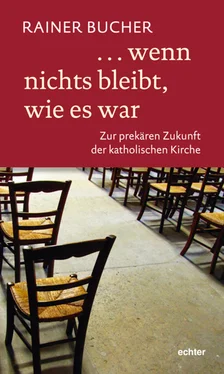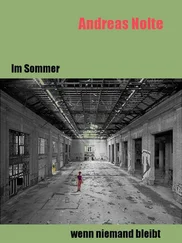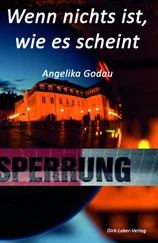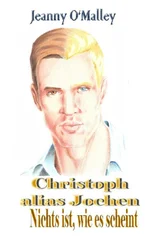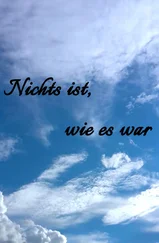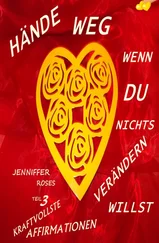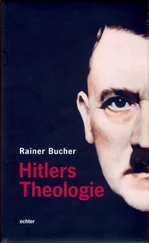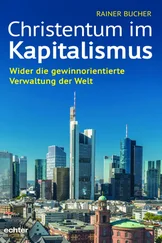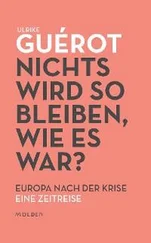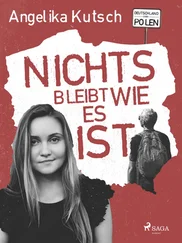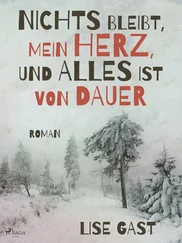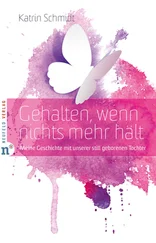Die Gemeindetheologie war der letzte Ausläufer des tridentinischen Projekts. Wie dieses suchte sie den Erosionsprozessen kirchlicher Sozialräume durch Verdichtung, Formierung und Überschaubarkeit gegenzusteuern, wenn auch diesmal unter typisch modernen Kategorien wie »Mündigkeit«, »Subjekt« und »Modernität«. Dies geschah auf familiaristischer Basis, schien doch damals die Familie die letzte stabile Sozialform der Moderne. Aber wie sich auch an der »Pfarrfamilie« erweisen sollte: dem war nicht so.
Der Versuch, die katholische Kirche von einer amtszentrierten Heilsinstitution zur quasi-familiären gemeindlichen Lebensgemeinschaft umzuformatieren, ist denn auch nicht am Widerstand der alten Kirchenformation gescheitert, sondern an seinem Charakter als halbierte, ja selbstwidersprüchliche Modernisierung, einem Widerspruch, wie er etwa schon in Klostermanns Doppelziel von Intensivierung und Expansion zum Ausdruck kommt. Die gemeindetheologische Modernisierung wollte freigeben (»mündiger Christ«) und gleichzeitig wieder in der »Pfarrfamilie« einfangen. Sie wollte Priester und Laien in ein neues gleichstufiges Verhältnis bringen bei undiskutierbarem Leitungsmonopol des priesterlichen »Vorstehers«. Sie wollte eine Freiwilligengemeinschaft sein, die aber auf ein spezifisches Territorium bezogen sein sollte, sie wollte für alle da sein, war es aber doch für immer weniger. Und man verengte die ehemals extrem aufgespannten Partizipationsgrade an Kirche zwischen Minimalpartizipation am unteren kirchenrechtlichen (und doch »heilsgewissen«) Rand und Totalhingabe auf das berühmte »aktive Gemeindemitglied« ausgerechnet zu jenem Zeitpunkt, als die Einzelnen die Lizenz zu sanktionsfreier religiöser Praxis bekamen.
Diese Selbstwidersprüchlichkeiten einer halbierten Modernisierung blieben nicht folgenlos. Aus ihrer inneren Widersprüchlichkeit entwickelten sich äußere Paradoxien: Die Gemeinde sollte das Leben in Christus vermitteln und musste doch offenbar selbst ständig »verlebendigt« werden, sie war auch in ihrem eigenen Selbstverständnis kein Selbstzweck, zog aber alle Bemühungen und Initiativen auf sich, sie war plötzlich die »Summe und Pointe aller Pastoral« 18, und doch expandierten die nicht-gemeindlichen Handlungssektoren der Kirche, also Diakonie, Kategorialpastoral oder Bildungsarbeit, weit stärker.
Der Kern der Selbstwidersprüchlichkeit des gemeindetheologischen Konzepts gründet in seinem ambivalenten Verhältnis zur Freiheit. Diese Ambivalenz aber rührt aus dem Status der Gemeindetheologie als kriseninduziertes Rettungsprogramm. Ähnlich wie das Papsttum im späten 19. Jahrhundert – und daher auch ähnlich emotional aufgeladen – zog die Gemeindetheologie enorme Rettungsphantasien einer durch die moderne liberale Gesellschaft und ihre ganz anderen Lebensstile unter Druck geratenen Kirche auf sich – wenn auch diesmal bei den eher modernitätsfreundlichen Teilen der Kirche. Doch in einem kommt sie mit der forcierten Papstkirche der Pianischen Epoche überein: Durch Aufbau, Ausbau und theologische Unterfütterung einer spezifischen Sozialform von Kirche sollten die freiheitsbedingten Erosionsprozesse kirchlicher Konstitution gestoppt werden.
Die Gemeindetheologie formuliert somit ein spezifisches innerkirchliches sozialtechnologisches Projekt. Sie verspricht Vergemeinschaftung jenseits der Repression einer »unverlassbaren« Schicksalsgemeinschaft und doch diesseits der unheimlichen und ungebändigten Freiheit des Einzelnen. Deshalb thematisiert die Gemeindetheologie auch primär Sozialformen, nicht aber pastorale Inhalte. Diese werden immer noch als Selbstverständlichkeit behandelt, mag diese Selbstverständlichkeit, etwa in der Sakramentenpastoral, auch noch so unübersehbar hinfällig geworden sein. Ähnlich wie beim Papsttum will man über eine institutionelle Struktur sichern, was in der liberalen Gesellschaft gefährdet erscheint: die Tradierung des Christlichen.
Dass dieses Projekt scheitern musste, erklärt sich aus seiner inneren Selbstwidersprüchlichkeit, dass es gerade in seiner intendierten Rettungswirkung scheiterte, ist offenkundig: Die Bindewirkung des gemeindlichen Milieus hat, nimmt man die Kirchgängerzahlen als Grundlage, seit 1950 um ca. 70 % abgenommen. 19Nicht dieser Vorgang an sich – er ist nicht so sehr der Gemeinde als vielmehr dem generellen Kontextwechsel kirchlicher Konstitution zuzuschreiben – als vielmehr die Tatsache, dass auch der gemeindetheologische Umbau praktisch keine Spuren in dieser linearen Reduktion kirchlicher Partizipation hinterlassen hat, ist bemerkenswert.
Zudem laufen praktisch alle ressourcenbedingten aktuellen pastoralplanerischen Initiativen darauf hinaus, das klassische »Normalbild« einer um den Pfarrpriester gescharten, überschaubaren, lokal umschriebenen, kommunikativ verdichteten Glaubensgemeinschaft aufzulösen. »Pfarreien werden zusammengelegt und so die pastoralen Räume vergrößert. Das bedeutet, dass ein Priester für weitaus mehr Gläubige zuständig ist als zuvor.« 20Dieser Prozess, gegenwärtig vielfach beklagt, vollzieht, wenn auch aus ganz anderen und nicht unbedingt guten Gründen, kirchenzentral nach, was die meisten Katholiken und Katholikinnen schon vorher von sich aus getan haben: den Abschied von der Utopie der »Gemeinde« als Gegenwelt unverstellt-personaler Kommunikation und realer Inklusion in einer Welt instrumenteller Kommunikation und Exklusion. Michael Ebertz hat Recht, wenn er feststellt, es sei »schon merkwürdig, dass … dieser so offensichtlich negative Ausgang eines gewissermaßen historischen Experiments immer noch ignoriert werden kann« 21. »Die meisten getauften und gefirmten Katholiken … verspüren schlicht kein Interesse an den hohen religiösen Ansprüchen der Gemeindebewegung und an der damit verbundenen Neuverteilung der religiösen Arbeit, die nun den Laien zugemutet wird. Sie haben schlicht andere Sorgen und Relevanzen.« 22
4. Die Gemeinde und die Zulassungsbedingungen zum Priestertum
Nun ist die jüngere pastoraltheologische Diskussion um die »Gemeinde« nicht nur sehr kontrovers, sondern auch argumentativ ausgesprochen extensiv verlaufen. 23Den großen Hoffnungen, mit denen die Gemeindetheologie startete, entsprechen die Emotionen, welche ihre aktuelle pastoraltheologische Problematisierung immer noch freisetzt. Dies ist verständlich, zumal gleichzeitig, wenn auch mehr oder weniger unabhängig davon, die damals angestrebte Gemeindeverfassung der katholischen Kirche in den aktuellen Umbauprozessen ihrer Basisstruktur 24tatsächlich zunehmend aufgelöst wird.
Diese zudem oft lebensgeschichtlich tief eingeschriebene Brisanz des Gemeindethemas hat zu einigen problematischen Verknüpfungen mit anderen Themen geführt. Diese Verknüpfungen sind möglich, behindern aber analytisch eher den Blick. Konkret betreffen sie die Frage der Zulassungsbedingungen zum Priesteramt, das Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft in christlicher religiöser Praxis sowie die Frage nach der notwendigen Verortung kirchlicher Pastoral in der räumlichen Fläche.
Ohne Zweifel sind die gegenwärtigen Zulassungsbedingungen zum katholischen Amtspriestertum ausgesprochen diskussionswürdig, vor allem unter Gerechtigkeits-, Qualitäts- und amtstheologischen Gesichtspunkten. Die Gemeindeproblematik dürfte aber kein geeigneter Hebel sein, um hier relevanten Veränderungsdruck aufzubauen. Das Konzept »Gemeinde« als eine kommunikativ verdichtete, überschaubare Lebens- und Glaubensgemeinschaft unter priesterlicher Leitung ist innerkatholisch viel zu jung, um als Gegengewicht gegen jene alten Traditionen anzukommen, die das Priestertum dem unverheirateten Mann reservieren.
Es wäre sicher wünschenswert und grundsätzlich, etwa einem Konzil, auch möglich, die Zulassungsbedingungen zum katholischen Weihepriestertum einer pastoraltheologischen wie einer systematisch-theologischen Evaluierung zu unterziehen. Dies wird in absehbarer Zeit aber wohl nicht geschehen, zu tief sind Ordnungen der Geschlechterdifferenz und Ordnungen des Religiösen auch in unserer Kirche amalgamiert. Die schwerwiegendste Konsequenz der gegenwärtigen Zulassungsbedingungen wird auch nicht einmal so sehr der wegen des Priestermangels notwendige Umbau der pastoralen Basisorganisation sein als vielmehr die zuerst schleichende, dann sich aber rapide beschleunigende kulturelle Entfremdung, ja Exkulturation der katholischen Kirche von einer Gesellschaft, die normativ, zunehmend aber eben auch real auf eine ganz andere Geschlechterchoreografie umgestellt hat und in der die alten Begründungsmuster für Geschlechterasymmetrien massiv an Plausibilität verloren haben. 25
Читать дальше