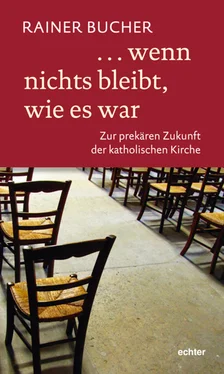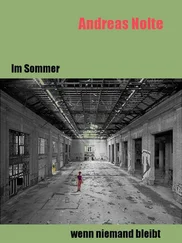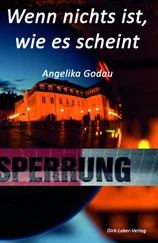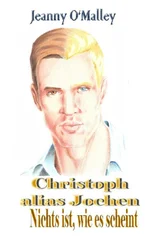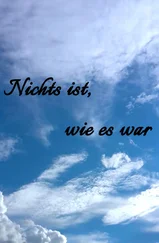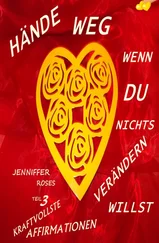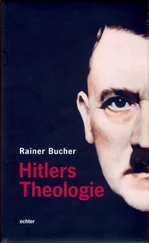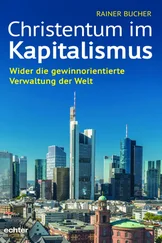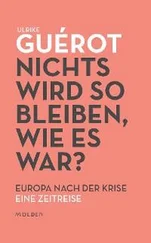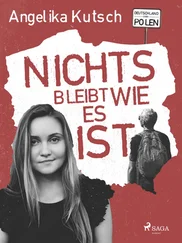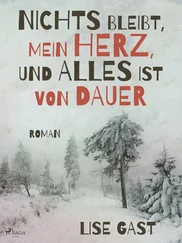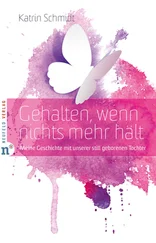Die kulturellen Basics unserer Existenz verändern sich unter der Oberfläche einer gewissen Kontinuitätsfiktion seit einiger Zeit fundamental, im Wesentlichen wohl immer noch durch einen einzigen Prozess: Der Bereich des Kulturellen – und damit als veränder- und verfügbar Definierten – weitet sich dramatisch aus. Das geschieht durch zwei miteinander verschränkte Prozesse: durch die Überführung von bislang als »natürlich«, also unwandelbar und notwendig Gedachtem in den Bereich des Gestaltbaren und durch die massive technologische Erweiterung dieses Bereichs.
Für die Überführung von bislang als natürlich, unwandelbar und notwendig Gedachtem in den Bereich des Gestaltbaren steht exemplarisch der Wandel des Geschlechterverhältnisses. Bis vor kurzem sprach man inner- und außerkirchlich ganz selbstverständlich vom angeblich unwandelbaren, ewigen »Wesen der Frau«, das sie »natürlicherweise« zur dienenden Partnerin des Mannes mache. Das ist inzwischen als eine für lange Zeit sehr erfolgreiche Männerphantasie durchschaut.
Für die Erweiterung des Bereichs des kulturell Gestaltbaren durch dessen technologische Expansion stehen exemplarisch die neuen digitalen Medien und die Biotechnologie. Es gibt natürlich auch kulturelle Revolutionen, in denen sich technologische Expansion und kulturelle Dekonstruktion von bisher Unantastbarem überschneiden. In den konkreten kulturellen Revolutionen der Gegenwart verschränken sich zumeist die Erweiterung des Bereichs des Gestaltbaren und die schiere Reichweitenexpansion menschlichen Handelns.
Die Medienrevolution etwa vollzieht sich primär als technologische Revolution, ist aber natürlich weit mehr als das. Die »Neuchoreografie der Geschlechterrollen« vollzieht sich primär als Entlarvung von scheinbar »Natürlichem« und »Gottgewolltem« als etwas Veränderbares, aber auch sie ist mehr als das, ist eine wirkliche Neuchoreografie und bringt daher die Verhältnisse zwischen Männern und Frauen zum Tanzen. 5Es ist kein Zufall, dass praktisch alle religiös-fundamentalistischen Bewegungen die Autonomie weiblichen Handelns massiv einschränken wollen. 6
Die ökonomische Globalisierung aber ist ganz offenkundig und unmittelbar die Folge der Kombination von beiden Elementen des kulturellen Expansionsprozesses. Während sich die Medienrevolution technologisch verkauft und vermarktet, aber weitreichende Verflüssigungskonsequenzen für bisherige kulturelle Unverrückbarkeiten nach sich zieht, die Revolution der Geschlechterrollen vor allem als Destruktion bislang gültiger Unwandelbarkeiten und ihre Überführung in Gestaltbares daherkommt, ihre Basis aber in der realen Ausweitung weiblicher Autonomie durch qualifizierte Erwerbstätigkeit hat, ist die ökonomische Globalisierung von vorneherein auf dem Feld der Politik, der Macht, der ökonomischen wie der politischen Imperien angesiedelt. 7
Dass sich die Gestaltungsreichweite des Menschen dramatisch durch die Entlarvung von Natürlichem als kulturell Gestaltbares und durch die Überführung von Fernem in Erreichbares erhöht, ist nichts wirklich Neues. Das geht schon lange so, seit mehreren Jahrhunderten. Das Neue dürfte aber darin liegen, dass der Wandel schneller und anders geschieht, als unser Begreifen und Planen es sich denken wollte.
Dies alles bedeutet nichts weniger als das faktische und unabweisbare Ende lang anhaltender und bis heute wirksamer Grundannahmen über unsere zeitliche Situierung. Nach Hartmut Rosa erleben wir gegenwärtig »das Ende der verzeitlichten Geschichte der Moderne, d.h. das Ende einer Zeiterfahrung, in der die historische Entwicklung ebenso wie die lebensgeschichtliche Entfaltung als gerichtet und kontrollierbar … erscheinen.« 8
3. Die merkwürdige Geschichte der »Gegenwart«
Die Gegenwart ist uns seit einiger Zeit doppelt entzogen: Als etwas, das uns drängend und distanzlos umgibt, war sie es schon immer. Als gegenwärtige Gegenwart aber ist sie es doppelt. Denn eine der merkwürdigeren Irritationen beim Blick auf die Gegenwart ist, dass es offenbar eine Geschichte des Bewusstwerdens der eigenen Zeit gibt. Die Gegenwart war offenbar nicht immer in jener Weise gegenwärtig, wie es uns heute selbstverständlich ist. Die Art des Gegebenseins der Gegenwart ist selber ein kulturelles Phänomen. Es gibt eine »Geschichte der Gegenwart«. In ein Schema gebracht: In vor-neuzeitlichen Zeiten, also vor der europäischen Expansion des 16. Jahrhunderts, war die Gegenwart die Verlängerung der Vergangenheit und sie wollte auch nichts anderes sein; in der Moderne, also bis vor kurzem, war die Gegenwart die Vorgeschichte einer erhofften, erstrebten besseren Zukunft; heute, in einer unsicher und vorsichtig gewordenen späten Moderne, ist sie vor allem eines: die Chiffre für die Unsicherheit darüber, was sie eigentlich ist.
Vor dem Epochenbruch zur Neuzeit waren Gegenwart und Zukunft die Fortsetzung der Vergangenheit. Wie es war und vor allem wie es sein sollte, das dachte man sich als die Fortsetzung eines legitimierenden Ursprungs. Herrschaft etwa, weltliche und religiöse, begründete sich vor allem durch die »Herkunft von alters her«, am besten von göttlichem, also ewigem Alter her. Gegenwart war Nachfolge.
Die Moderne wurde dann jene Zeit, in der man die Zukunft als Projekt der Gegenwart dachte: Man sah sich nicht mehr primär der Vergangenheit verpflichtet, sondern die Zukunft wurde zur normativen Zeitebene, eine »bessere« Zukunft natürlich. Es sollte nicht mehr wie früher, sondern ganz anders werden, die Zukunft wurde modellierbar und gestaltbar, wurde zur Aufgabe. Der Weg dorthin nannte sich recht emphatisch »Fortschritt«.
Die Moderne bricht mit einer vergangenheitsorientierten Logik des Ursprungs und etabliert stattdessen eine zukunftsorientierte Logik des Projekts. Das befreit die Vergangenheit von der Aufgabe, die Gegenwart zu bestimmen, ermöglicht dieser vielmehr umgekehrt, die Vergangenheit nun plötzlich als offenen Raum der Erforschung zu entdecken. Hier drehen sich die Herrschaftsverhältnisse um: Nicht mehr die Vergangenheit herrscht über die Gegenwart, sondern die Gegenwart über die Vergangenheit. Diese Gegenwart selber aber steht unter der Macht der Zukunft.
Während die Gegenwart in vormodernen Zeiten also die Zukunft der Vergangenheit war, so in modernen Zeiten die Vergangenheit der Zukunft. Dieser Zukunft war man sich dabei relativ sicher. Die klassische Moderne, die Zeit also, die sich ihres regulierenden theologischen Rahmens irgendwann im 18. Jahrhundert in ihren Eliten und im 19. Jahrhundert dann gesellschaftsweit entledigte, war noch das Projekt einer nach-metaphysisch legitimierten Gesellschaft mit quasi-metaphysischer Sicherheit, das Projekt einer nicht-religiös begründeten Gesellschaft mit fast noch religiöser Selbstsicherheit.
In der postmodernen Gegenwart finden Geschichtstheologien des Fortschritts nicht mehr wirklich Glauben. Die Gegenwart ist damit eine Zeit, die sich ihrer selbst nicht mehr so gewiss ist, wie es die Vormoderne im Rahmen einer religiösen und die Moderne im Rahmen einer säkularen Geschichtstheologie war. Die spät- oder zumindest darin postmoderne Gegenwart ahnt die Brüchigkeit der modernen Logik der Projekte. Sie baut weiter an der Welt der Zukunft als Ergebnis ihres Willens, aber sie ahnt, dass es ganz anders kommen wird. Die Zukunft wird nicht das sein, was wir heute geplant haben. Was wir heute planen, wird die Zukunft mitbestimmen, aber wie, wissen wir nicht.
Der ganze Wissenschaftsbetrieb und teilweise auch die Kirche werden zwar gegenwärtig noch auf das Schema der Moderne umformatiert: 9ein Projekt zu entwickeln, es zäh und gegen widrige Winde und Menschen durchzusetzen und mit Erfolg abzuschließen. Wenn es aber eine postmoderne Erkenntnis gibt, dann jene, dass wir nicht die souveränen Herren der Zukunft sind, wie es die Moderne glauben machen wollte. Der Nationalsozialismus wollte die Weltherrschaft der Deutschen, er hat sie in ihr größtes moralisches und materielles Elend geführt. Der Kommunismus glaubte die Geschichte verstanden und die neue Zeit mit sich zu haben, hat sie aber seit 1989 hinter sich. Der liberale Westen glaubte, die Religion abgekühlt zu haben, aber er hat sie mit seiner kulturellen Globalisierung an verschiedenen Stellen wieder heiß gemacht. Der Irakkrieg sollte den islamischen Fundamentalismus beseitigen, er hat ihn aber gestärkt. Die moderne Verkehrstechnologie sollte die Erde verfügbar machen, ihr CO 2-Ausstoß droht sie aber in Teilen unbewohnbar werden zu lassen. Die globalisierten Finanzmärkte sollten Wohlstand ermöglichen, ihre enge Vernetzung droht sie unbeherrschbar zu machen, der Euro sollte Europa endgültig einen und droht jetzt, zu seinem Sprengsatz zu werden.
Читать дальше