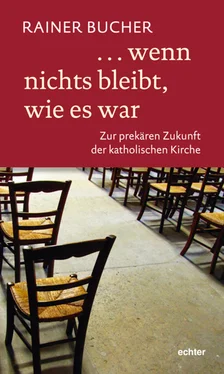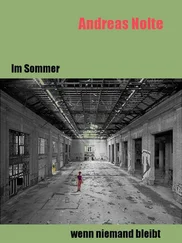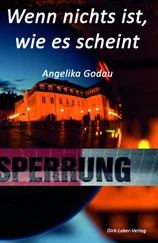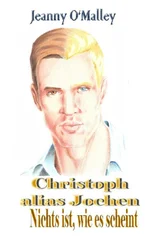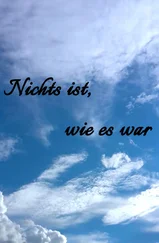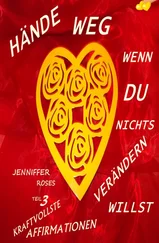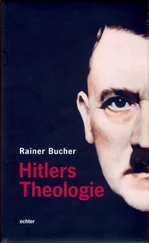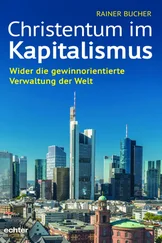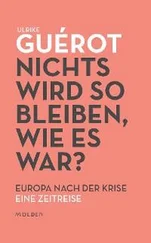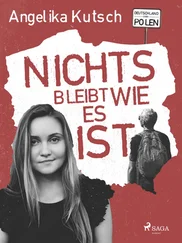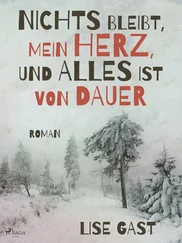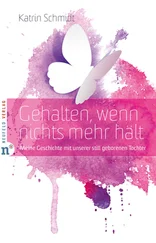In der vorliegenden Publikation werden Analysen und Vorschläge zur Lage und Zukunft der katholischen Kirche in unseren Breiten gebündelt, die in den letzten Jahren an verschiedenen Stellen entwickelt und veröffentlicht wurden, und einem breiteren Publikum vorgelegt. Die Auseinandersetzung mit alternativen Analysen und Optionen wird in diesem Buch nur zurückhaltend geführt. Wer sich hierfür interessiert, der sei für die Grundlagenfragen auf die Publikation »Theologie im Risiko der Gegenwart«, Stuttgart 2010, und für pastorale Einzelprobleme auf »Orte und Prozesse. Studien zu den aktuellen Konstitutionsproblemen der deutschen katholischen Kirche« verwiesen; dieses Buch hoffe ich 2013 vorlegen zu können.
Wieder einmal habe ich Frau Ingrid Hable, meiner Mitarbeiterin am Grazer pastoraltheologischen Institut, sehr herzlich zu danken und auch Heribert Handwerk, dem Lektor des Echter Verlags. Die Zusammenarbeit mit ihnen gehört zu den wirklichen Freuden meines beruflichen Lebens.
Ich widme diese kleine Schrift jenen, die an der Basis der katholischen Kirche redlich und voller Engagement versuchen, in den Steppen des persönlichen wie kirchlichen Alltags ein Zeichen und Werkzeug der Liebe Gottes zu sein.
Rainer Bucher Graz, 12. Februar 2012
Verflüssigungen
I. Die Unvorstellbarkeit der Zukunft
» Am Ende dieses Jahrhunderts war es zum erstenmal möglich, sich eine Welt vorzustellen, in der die Vergangenheit (auch die Vergangenheit der Gegenwart) keine Rolle mehr spielt, weil die alten Karten und Pläne, die Menschen und Gesellschaften durch das Leben geleitet haben, nicht mehr der Landschaft entsprachen, durch die wir uns bewegten, und nicht mehr dem Meer, über das wir segelten. Eine Welt, in der wir nicht mehr wissen können, wohin uns unsere Reise führt, ja nicht einmal, wohin sie uns führen sollte.«
E. Hobsbawn 1
»Die … kulturelle Krisenerfahrung liegt in dem gleichzeitigen Verlust einer referenzstiftenden Vergangenheit und einer sinnstiftenden Zulunft.«
H. Rosa 2
1. Das Neue am Neuen: ein kleines Gedankenexperiment
Ich möchte Sie in einem kleinen Gedankenexperiment dazu einladen, sich in das Jahr 1987 zurückzuversetzen. Oder gehen Sie einfach so weit zurück, als es Ihnen möglich ist. Erinnern Sie sich, wo Sie damals lebten, was Sie beschäftigte, bei wem und mit wem Sie lebten und vor allem: was Sie damals erstrebten, erhofften und von der Zukunft erwarteten.
Und dann führen Sie sich vor Augen, was seither tatsächlich in Ihrem Leben passiert ist.
Ihre Erfahrungen gehören natürlich nur Ihnen. Aber ich vermute, dass manches, vielleicht sogar vieles von dem, was in Ihrem Leben seither passiert ist, für Sie recht weit außerhalb Ihrer damaligen Vorstellungen lag.
Dieses kleine Gedankenexperiment lässt sich auch für die öffentliche Erinnerung anstellen. Dann liegen zwischen 1987 und heute der Zusammenbruch des Kommunismus, die Verbreitung von PCs, Internet und Handys, der Fastzusammenbruch des internationalen Finanzsystems, die unabweisbare Erkenntnis eines globalen Klimawandels mit apokalyptischem Drohpotential, der Beinahekollaps des in dieser Zeit überhaupt erst eingeführten Euros, die Wahl eines Afroamerikaners zum Präsidenten der USA und ein deutscher Außenminister, der offiziell mit seinem angetrauten Ehemann reist.
So unterschiedlich all diese Phänomene sind, sie haben eines gemeinsam: Sie kamen ziemlich unerwartet und waren jeweils noch kurz vorher kaum vorstellbar. Natürlich war die Zukunft immer schon ungewiss, praktisch unvorstellbar aber ist sie erst seit kurzem. Alles spricht dafür, dass es damit nicht vorbei ist. Es wird damit weitergehen, dass wir nicht wissen, wie es weitergehen wird. In 25 Jahren wird uns vieles überrascht haben und wir können uns heute noch nicht einmal vorstellen, was es sein wird. Was wir uns heute vorstellen, dass es kommen wird, wird nicht das sein, was kommen wird: Das lehren die letzten Jahrzehnte. Dass Neues kommt, wussten Menschen schon immer, dass das Neue aber mitunter weit außerhalb unserer Vorstellungskraft liegt, das ist wirklich neu. Die zentrale spätmoderne Erkenntnis besteht darin, dass es anders kommen wird als geplant, weil es anders ist, als wir denken, und die Zukunft zwar die Folge unserer Projekte sein wird, aber diese Folgen ganz andere sein werden, als man erwartete. 3
Zum Verstörendsten an solcherart Neuem zählt, dass zu seiner Analyse zuerst nur alte Kategorien zur Verfügung stehen. Am »Automobil«, dem teuersten Konsumprodukt unserer Gesellschaft, kann man das gut demonstrieren. Sein Name – das »Sich-selbst-Bewegende« – markiert bis heute eine Differenz zur Kutsche, die ohne Pferd schlicht nur herumstehen konnte. Die ersten »Autos« sahen denn auch tatsächlich noch aus wie Kutschen ohne Pferde. Heute aber ist am Automobil vieles interessant und spannend: dass es »sich selbst bewegt« eher nicht, das ist zur Selbstverständlichkeit geworden.
Die Entdeckung von wirklich Neuem verläuft normalerweise in drei Phasen: Zuerst ist da die schiere Erfahrung, dass etwas da ist, was so noch nicht da war, und das deswegen irritiert und fasziniert. Es wird hier noch mittels der Differenz zum bisher Gewohnten benannt. Nach und nach setzt sich dann die Einsicht durch, dass es sich wirklich um etwas Neues handelt. Man merkt: Das Auto ist viel mehr als eine Kutsche ohne Pferde. Dann erst folgt aber, was am schwierigsten ist: die nie abgeschlossene Entdeckung des Neuen unter wirklich neuen, erst zu entwickelnden Kategorien. Um im Beispiel zu bleiben: Was bedeutet es sozial, technisch, ökonomisch, ökologisch, landschafts- und städteplanerisch, eine Gesellschaft umfassend per Auto zu mobilisieren?
Kolumbus zum Beispiel kam nicht wirklich über Phase eins hinaus. Er sah Land am Horizont und erkannte auch nach und nach, dass es nicht Indien war, wo er gelandet war, hielt es aber für etwas bereits anderweitig Bekanntes: für Asien. 4Er segelte übrigens gegen die sehr gut begründeten Widerstände der Geografen los, welche den Erdumfang recht korrekt berechnet hatten und ihm völlig zu Recht vorhersagten, dass er nicht herumkäme um die Erde mit seinen kleinen Schiffen. Dass zwischen Europa und Indien noch »Amerika« lag, wussten beide nicht und wurde erst Jahre später erkannt. Manchmal führen kreative Fehler zur Entdeckung ganzer Kontinente. Hätte Kolumbus entdeckt, wo er gelandet war, wäre das erst die wirkliche Entdeckung des Neuen als etwas Neuem gewesen, Phase drei wäre dann die Einsicht gewesen, dass die Entdeckung neuer Kontinente auch die alten nicht unverändert lässt, eine Erfahrung, die Europa seitdem bis heute macht.
Dass das Neue selbst erst in seiner Neuheit entdeckt werden muss, ist die Konsequenz der Tatsache, dass die menschliche Zeit – zumindest unter irdischen Normalbedingungen – immer in eine Richtung verläuft. Wir können nicht, wie etwa Gott, aus der Zukunft in die Vergangenheit schauen oder gar in einer ewigen Gleichschau der Zeitlichkeit entgehen.
2. Kulturelle Revolutionen
Unter der Benutzeroberfläche unseres Alltags werden seit einiger Zeit permanent neue Programme installiert, ohne dass die Programmierer wissen können, wohin das führt. Das geschieht zumeist knapp unterhalb der Wahrnehmungsschwelle; wenn wir es merken, ist es schon passiert. Auch das trägt dazu bei, dass das Leben heute sich vom Leben unserer Großeltern fundamental unterscheidet.
Diese kulturellen Revolutionen kommen zuerst eher leise daher, das ist eines ihrer postmodernen Erfolgsgeheimnisse. Die Gegenwart – das ist, im Unterschied zur klassischen Moderne, die Zeit der Revolutionen, die schon mehr oder weniger durchgesetzt sind, wenn sie bemerkbar werden. So beginnen wir erst zu ahnen, was die Umwälzungen der späten Moderne bereits alles auf den Kopf gestellt haben und noch auf den Kopf stellen werden.
Читать дальше