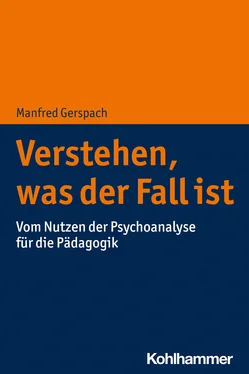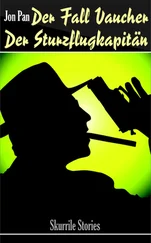Ähnliches gilt für Vorgänge in sozialen Gruppen. Dem Sog der Gemeinschaft, sich auf eine Idee zu verpflichten, haftet ein regressives Element an, welches das Reflexionsvermögen infiltriert. Die Individuen sehen sich genötigt, ihren Wunsch nach autonomem Denken und Handeln einzuschränken oder ganz aufzugeben. So unterwerfen sie sich der allgemein geteilten Ideologie aus Angst, Liebe und Schutz der Gemeinschaft zu verlieren, oder sie tun es gar freiwillig, ganz im Dienste der »Identifikation mit dem Aggressor« (Freud, A. 1980, S. 298). Diese Vorgänge verhindern die (Selbst-)Aufklärung. Eggert-Schmid Noerr hat aufgezeigt, dass Reflexion am geeignetsten auf der Basis psychoanalytischer Theorie erfolgt (vgl. Eggert-Schmid Noerr 2010, S. 27). Dabei gilt: »Keine psychoanalytische Zeitdiagnose kommt ohne Gesellschaftstheorie aus; die Annahme, das bräuchte man nicht, ist im Übrigen auch eine Gesellschaftstheorie, wenn auch keine elaborierte.« Die »Deutungsangebote«, die sie parat hält, weisen der Realität einen bestimmten Sinn zu, sind daher nur reflexiv zugänglich und zwangsläufig von einer gewissen Befangenheit begleitet (vgl. Kirchhoff 2019, S. 31; Brede 1997, S. 876).
Vielleicht kommt hier ein gewisser Neid ins Spiel. Gewinnen die Gefühle von Kränkung und Ohnmacht die Oberhand, weil man weiß oder mutmaßt, im Vergleich mit anderen etwas nicht zu können, wird die Phantasie vom grandiosen Selbst beschädigt. Dann entstehen lähmende Gemütsregungen von Scham und Zorn, und man empfindet Neid auf die anderen, die es scheinbar viel besser können. Zudem steht Neid mit dem vitalen Bedürfnis nach narzisstischem Wohlbefinden in enger Beziehung, nicht zuletzt dann, wenn man sich zurückgesetzt zu fühlen beginnt.
Ich meine konkret den Neid auf die Psychoanalytischen Pädagog/innen. Auf der manifesten Ebene zeigt sich bei ihnen eine eifersüchtig belauerte Fähigkeit, Belastungen eher auszuhalten und mit »Problemkindern« besser umgehen zu können. Auf der latenten Ebene kennen sie offenbar keine Angst davor, mit dem, was sie »Unbewusstes« nennen, in Berührung zu kommen. Wenn dagegen Angst und Neid vor sich und anderen nicht eingestanden werden dürfen, werden sie in einem Akt der Gegenbesetzung erbittert diskreditiert.
Seit dem Abgesang auf die ›großen Erzählungen‹ – humanistische, strukturalistische, marxistische usw. Weltformeln –, die als Hilfs-Ich dienten, ist die Flucht in eine sichere Theorie obsolet geworden ist (vgl. Lyotard 2012). Aber die Folgen sind doch unterschiedlich. In Verbindung mit dem Untergang des sowjetischen Imperiums führte dieser akademische Kollaps vor allem für die politisch dogmatischen Strömungen innerhalb der Wissenschaftsgemeinde zu einer enormen emotionalen Labilisierung. Diejenigen, denen dadurch ihr stärkendes externalisiertes Über-Ich verloren ging, fanden so einen Grund, auf alle neidisch zu sein, die ihre – von Skepsis und Ambiguitätstoleranz, Spannungen auszuhalten, gleichermaßen getragene – Sicherheit aus dem Mut schöpften, nicht nur die gesellschaftlichen Verhältnisse, sondern auch und zuallererst das Eigene in Frage zu stellen. Fortan wurde deren Gedankengebäude umso schärfer zuerst ignoriert, und wenn das nichts mehr half, attackiert. Wollte man ihnen vielleicht etwas wegnehmen, was man selbst nicht besaß? Bei aller Ehrfurcht vor dem hohen Gut akademischer Diskurse müssen solche Fragen an den unbewussten psychodynamischen Kern erlaubt sein, der solche Diskurse anstößt und trägt. Aber ich will nicht selbstgerecht sein.
Im Alten Testament steht zu lesen, dass Jakob seinen Sohn Joseph mehr als seine anderen elf Söhne liebt und ihm ein schönes, buntes Kleid schenkt. Daraufhin ziehen sie ihm in einem unbeobachteten Moment das Kleid aus und werfen ihn in einen trockenen Brunnen. Diepold macht darauf aufmerksam, dass Joseph sich sehr wohl seiner Bevorzugung durch den Vater und des Neids seiner Geschwister bewusst war, er narzisstische Züge entwickelte und »seine Überlegenheit bei allen möglichen Gelegenheiten« demonstrierte (vgl. Diepold 1990, S. 275). Joseph ist also nicht nur Erleider, sondern auch Verursacher von Neidgefühlen. Der Neid gilt deshalb auch als moralisch verwerflich, weil wir Angst vor dem Neid der anderen haben und zugleich Lust, sie neidisch zu machen (vgl. Haubl 2009, S. 170; Gerspach 2021). Und da sind wir Psychoanalytischen Pädagog/innen ganz ordentlich gefährdet.
Mein persönliches Problem im Kleinen – und das der Psychoanalytischen Pädagogik im Großen – sind jetzt, dass durch die Aufdeckung solcher möglichen Motive im Dienste einer inneren Abwehr der Widerstand womöglich nur noch größer wird. Dabei muss ich aufpassen, dass meine Gedanken nicht als schnöde Beschimpfung oder aus reiner Kränkung geboren daher kommen. Mir geht es primär darum zu verstehen, warum die Psychoanalyse beinahe vollständig aus der Pädagogik verschwunden ist und dass ich umgekehrt weiß und sichtbar machen möchte, dass durch ein Bearbeiten der eigenen Widerstände ein Mehr an Erkenntnis erreicht wird. Das betrifft sowohl die Theoriedebatte, die zu lebende Praxis und die erfolgreich zu gestaltende Forschung. Es gilt, ganz neu für die Psychoanalytische Pädagogik zu entflammen.
1.3 Die »Matrix« der Psychoanalytischen Pädagogik
Ich komme jetzt auf die allgemeine Bedeutung von pädagogischen Gruppenprozessen zu sprechen, die gerne aus dem Auge verloren wird. Angelehnt an Foulkes verweist Naumann auf das Gewicht der Gruppenmatrix, die er noch einmal unterteilt. Die Grundlagenmatrix ist jenes »übergeordnete gesellschaftliche Netzwerk, in dem jede Gruppe mit ihrer dynamischen Matrix stattfindet und in dem die Menschen miteinander vernetzte Knotenpunkte bilden« (vgl. Naumann 2014a, S. 53 f.). In der dynamischen Matrix wiederum wirken die verinnerlichten Beziehungen, die Beziehungen innerhalb der Gruppe und der Beziehungen, in die ihre Mitglieder außerhalb eingebunden sind, zusammen. »In der Gruppe wird die innere Matrix wiederbelebt, die Einzelnen bevölkern die Gruppe gleichsam mit ihren inneren Beziehungsobjekten (…)« (vgl. ebd., S. 60).
In das Konzept des szenischen Verstehens sollte unbedingt eine gruppenanalytische Perspektive integriert werden, so wie es Naumann tut, um die Bedeutung der Gruppe für die Entwicklung der Einzelnen – wie auch die Bedeutung der pädagogischen Institution für die Gruppe angemessen zu würdigen. Unter günstigen Ausgangsbedingungen, wenn die Gruppengrenzen genügend gut geschützt sind, kann etwa eine Kindergruppe zum »Übergangsraum für Selbstbildungsprozess, in dem spielerisch auch ernste Themen, etwa im Hinblick auf Familie, Geschlecht und Kultur«, Aufnahme finden. Zudem erhält hier jedes Kind Antworten von der Gruppe (vgl. ebd., S. 112 ff.). Das folgende Beispiel von Brandes mag dies veranschaulichen:
Der vierjährige Franz erscheint eines Morgens in seinem Kindergarten mit einem Xylophon. Auf der Frage seiner Erzieherin, ob er ein Konzert geben möchte, stimmt er freudig zu. Die Eltern von Franz sind professionelle Orchestermusiker, indessen ihrem Kind gegenüber sehr einfühlsam und überfordern es nicht.
Die anderen Kinder sind von dieser Idee begeistert und setzen sich kreisförmig um Franz und sein Xylophon herum. Franz beginnt aber nicht zu spielen, sondern kratzt sich nur mit den Schlägern am Kopf. Die anderen beginnen miteinander zu reden oder begutachten neugierig das Instrument mitsamt den Buchstaben auf den Metallplättchen. Buchstaben können sie schon unterscheiden und die Erzieherin erklärt, dass es die »Noten« sind, damit der Musiker weiß, worauf er schlagen muss. Nun ist die Aufmerksamkeit wieder ganz bei Franz. Alle erwarten den Beginn seines Konzertes, aber wieder spielt er nicht, sondern schaut sich nur um. Diese unklare Wartesituation wird schließlich von der Erzieherin unterbrochen, indem sie fragt, ob er jetzt anfangen wolle. Franz schüttelt den Kopf. Einige Kinder stehen auf, um ein noch fehlendes Kind zu holen, das aber nicht will.
Читать дальше