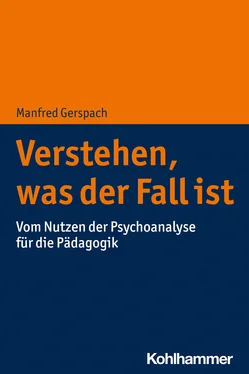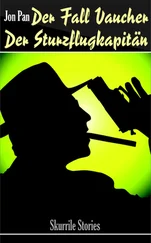Dabei führt die interpersonale, »tief unbewusst verbundene zweite Psyche« jene Differenzen ein, die den Patienten nötigen, »Unbekanntes zu entdecken und Bekanntes als Unbekanntes erneut zu denken« (vgl. Nissen 2009, S. 373). Immer wieder bin ich erstaunt über die große Nähe der beiden Disziplinen Psychoanalyse und Pädagogik, die genau an diesem Punkt einer professionellen, dialogisch begriffenen Beziehung aufscheint. Hier hat man sich – ungewollt und vielleicht noch unverstanden – aufeinander zubewegt.
Vor allem begegnen mir hier Formulierungen über das Unbekannte und Nicht-Gewusste, die mittlerweile geradezu irritierend ›unwissenschaftlich‹ klingen und die sich bruchlos in ein psychoanalytisch-pädagogisches Konzept einpassen lassen
»Was heute fast ausschließlich zählt, sind harte Daten, durch möglichst wenig theoretische Komplikationen verstellte Befunde (…) Übersehen wird dabei allerdings leicht, dass die evidenzbasierte Forschung häufig Komplexitätsreduktionen vornimmt, die von einem erheblichen Mut zur Vergröberung zeugen« (vgl. Ahrbeck 2007, S. 38 f.; Gerspach 2009, S. 58 f.).
Diese Haltung des vorsichtigen Herantastens an das noch Unverstandene liefert auch und gerade der Pädagogik eine ausgezeichnete Basis für ein beziehungsgestütztes Arbeitsbündnis. Alle darauf aufruhenden Forschungsaktivitäten und Theoriedebatten haben die Psychoanalytische Pädagogik in den letzten Jahren und Jahrzehnten entscheidend vorangebracht und stabilisiert.
Vor allem Siegfried Bernfelds weitreichende Erkenntnis vom »sozialen Ort«, der gänzlich unterschiedliche Auswirkungen auf die Entwicklung von Neurose und Verwahrlosdung nimmt, muss hier mitgedacht werden. Das seelische Geschehen ist gerahmt von den gesellschaftlichen Lebensbedingungen, und die »Triebe selbst mitsamt ihren Eigenschaften und Zielen sind der Niederschlag« dieses historischen Geschehens. Deshalb gilt: »Die ›Schwere‹ einer Erkrankung ist oft geradezu von ihrem sozialen Ort abhängig« (vgl. Bernfeld 1970, S. 198 f.).
Jüngst haben Brunner u. a. diese Perspektive noch einmal aufgegriffen. Sie betonen, dass es nur eine eingehende »Reflexion auf die klassen- und milieuspezifische Lage der Individuen« ermöglicht, sowohl das Hervorbringen innerpsychischer Konflikte als auch die Reduktion oder Kanalisation spezifischer Konfliktlösungsstrategien zu verstehen und damit unterscheiden zu können, ob »ein Verhalten als ›pathologisch‹ eingeschätzt oder eine Sublimierung als ›gelungen‹ wahrgenommen wird« (vgl. Brunner u. a. 2012, S. 23). Ob unbewusste Wünsche und Phantasien innerpsychische Konflikte hervorbringen, ist davon abhängig, »was innerhalb des sozialen Ortes als verpönt« gilt. Damit ist auch apodiktisch festgelegt, dass Forscher/innen den sozialen Ort ihrer Forschungssubjekte zur Kenntnis nehmen und reflektieren müssen (vgl. Thoen-McGeehan 2020, S. 44).
Bernfeld war also sehr weitsichtig. Mit einem sozusagen professionstheoretischen Blick auf fundamentale Unterschiede lautet seine Conclusio, der Psychoanalytiker sei imstande, dem sozialen Ort gegenüber neutral zu sein, »der Pädagoge kann diese grundsätzliche Toleranz nicht üben« (vgl. Bernfeld 1970, S. 203; Fickler-Stang 2019, S. 132).
Die sich hier abzeichnende frühe Ausdifferenzierung in Psychoanalytische Pädagogik und Psychoanalytischer Sozialarbeit bringt aber nur vordergründig Unterschiede hervor, die wohl vor allem dem der tendenziellen Andersartigkeit der Arbeitsfelder geschuldet sind. Das ›Kerngeschäft‹ der Pädagogik sind noch immer primär Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen, und da ist selbstverständlich Nähe zur Psychoanalyse als einer Sozialisationstheorie einerseits und einem Therapieverfahren zur Behandlung des in diesem Kontext entstandenen seelischen Leidens andererseits quasi naturgegeben. Das Aufgabengebiet der Sozialarbeit ist viel heterogener beschaffen, und oftmals scheint der sozialisatorische Aspekt nur mittelbar durch. Vielleicht ist der Arbeitsauftrag der Psychoanalytischen Sozialarbeit sogar noch um einiges diffuser als jener der Psychoanalytischen Pädagogik. Perner jedenfalls sieht diese Schwierigkeit:
»Wenn er [der psychoanalytische Sozialarbeiter; M.G.] sich auf die unaufdringliche, passive, abwartende und rezeptive Haltung des Analytikers beschränken würde, könnte er ewig warten und hätte nichts zu tun, weil seine Klienten dann gar nicht kämen oder nach wenigen Sitzungen wegbleiben würden. Er kann darum die Entwicklung einer positiven und tragfähigen Übertragung nicht ruhig und gelassen abwarten sondern muss aktiv für ihre Herstellung sorgen (…)« (vgl. Perner 2010, S. 68).
Erziehung und Bildung auf der einen Seite weisen eine gewisse Verzahnung auf, verbunden mit einem eher klaren Auftrag zur allgemeinen Wissensvermittlung. Die Aufgabenzuteilung der Sozialen Arbeit auf der anderen Seite erfolgt in der Regel durch das Aktivwerden von Jugend- und Sozialämtern, wenn sich vor Ort überdeutlich Problemlagen artikulieren. Das bringt die Zielgruppen, die zumeist den randständigen Milieus angehören, auf doppelte Weise in eine defensive Position. Die Umgebung – nicht zuletzt die Schule – wird aufmerksam und verlangt nach staatlicher Intervention. Die Beschämung auf Seiten der Betroffenen wird somit potenziert und erschwert den Aufbau eines soliden Arbeits- und Entwicklungsbündnisses. Dass das professionelle Scheitern bei Sozialarbeiter/innen damit quasi vorprogrammiert ist – und also das Beschämungsstigma am Ende auf sie zurückfällt –, macht eine jüngst erschienene Publikation überdeutlich sichtbar. Sie zeigt aber auch auf, wie und unter welchen Bedingungen helfende Beziehungen erfolgreich und nachhaltige Wirkungen bei den »Fällen« generierend verlaufen können (vgl. Fischer u. a. 2019). Überdies ist einzuräumen, dass auf dem Feld der Pädagogik wie der Sozialarbeit der gern verwendete Begriff der »Beziehungsarbeit« von einem nicht unbedeutenden diffusen Anteil mitgeprägt wird (vgl. Pollak 2002, S. 81 f.).
Spätestens über die auch auf dem Gebiet der Sozialarbeit virulent werdenden Prozesse von Übertragung und Gegenübertragung und die Einsatzmöglichkeiten des szenischen Verstehens, das ich sogleich noch eingehender behandeln will, wird die Unterschiedlichkeit also wieder vernachlässigbar. Von viel größerem Interesse sind die großen Gemeinsamkeiten, und es machen sich auch nur wenige inhaltliche oder methodische Divergenzen bemerkbar (vgl. Günter, Bruns 2010, S. 36 ff.).
Zudem springt ins Auge, dass es eine Reihe von Schnittmengen zwischen den beiden Arbeitsfeldern gibt. So verwundert es nicht, dass gerade die Kinder und Jugendlichen, die mit den normativ-mittelständisch gewirkten Anforderungen der Regelschule nicht ohne weiteres zurechtkommen und in den Fokus besonderer pädagogischer Bemühungen geraten, mehrheitlich aus sozialen Randlagen stammen. Meist stoßen wir auf von massiven seelischen Erschütterungen bedrohte Lebenswelten der jeweiligen Adressat/innen, und dies verlangt zwingend nach einer gesellschaftlichen Verortung unseres Tuns, um der erlebten – aber nicht verstandenen – Entfremdung unserer Adressat/innen nicht noch eine weitere Unterwerfungsgeste zuzumuten.
In beiden Professionen ist zudem Aufklärung zu leisten über ihre institutionelle Rahmung. Gesellschaftliche Institutionen neigen zur Idealisierung ihrer eigenen Vorstellungen und verteidigen sie gegen Angriffe (vgl. Ludin 2013, S. 127). Ein Wissen über diese im Innern wirkende Dynamik wird eher aus Gründen des Selbstschutzes massiv abgewehrt. Die Institution und ihre Repräsentant/innen fürchten um Prestige- und Machverlust, die Mitarbeiter/innen fürchten die ihren Narzissmus kränkende Gewissheit, in ihrer untergeordneten Rolle depotenziert zu sein. Hier kommt der Latenzschutz zum Tragen. Zum ersten gibt es den »Strukturschutz durch Latenz«: Institutionen schützen ihre Strukturen und damit ihre Stabilität, indem sie alles, was diese Strukturen unkontrolliert verändern könnte, latent zu halten suchen. Zum zweiten den »Schutz der Latenz« selber: Institutionen versuchen zu verhindern, dass die Latenz als solche überhaupt aufgedeckt und zur Sprache gebracht wird (vgl. Haubl 2011, S. 202; Gerspach 2020a, S. 31).
Читать дальше