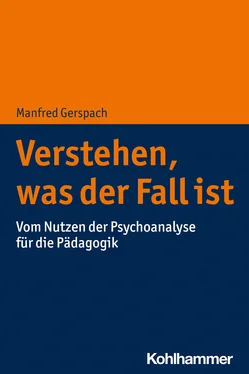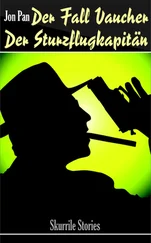Nun soll es endlich losgehen und alle sind erwartungsvoll, aber Franz beginnt immer noch nicht, sondern schaut etwas unsicher um sich. Die Erzieherin versucht, die lähmende Pause zu überbrücken, indem sie die Kinder zum Beifall-Klatschen auffordert, das bräuchten Musiker am Anfang. Immer begeisterter beginnen die Kinder zu klatschen. Franz lächelt zwar, aber beginnt trotzdem nicht. So geht es noch eine ganze Zeit weiter. Die Kinder werden unruhiger, beschäftigen sich untereinander oder gehen in den Nebenraum. Das Konzert droht zu scheitern.
Dann steht Peter, der Freund von Franz, auf, fragt, ob er etwas pfeifen dürfe, und beginnt »Alle meine Entchen« zu intonieren. Die Erzieherin nimmt den Vorschlag auf und sagt: »Wunderbar, jetzt haben wir ein Pfeifkonzert.« Sie schickt Peter los, um die verloren Gegangenen zu holen, und einige von ihnen kommen mit ihm zurück. Es beginnt ein Pfeifkonzert, an dem nicht nur Peter beteiligt ist, sondern in das immer mehr Kinder einfallen. Selbst ein weinendes Mädchen, das sich im Nebenraum gestoßen hatte, wird einbezogen und kann getröstet werden. Franz steht jetzt nicht mehr so im Mittelpunkt, so dass er seine Zurückhaltung aufzugeben und sich in das jetzt gemeinschaftliche Konzert immer wieder durch kurze Schläge auf sein Xylophon einzubringen vermag.
In seiner Interpretation geht Brandes von der Reinszenierung eines zentralen Identitätsdilemmas von Franz aus. Er möchte gerne ein Konzertmusiker wie seine Eltern sein, indessen kann er noch gar nicht richtig Xylophon spielen. In ähnlichen Situationen behilft er sich dadurch, auf später, wenn er ›groß‹ ist, zu verweisen, und dann Cello zu spielen. In diesem Moment aber inszeniert er seine ganze Ambivalenz und strapaziert damit die Geduld der Erzieherin und der anderen Kinder. Allerdings wird in der Kindergruppe die »Umarbeitung eines solchen inszenierten Selbstbildproblems« geleistet. Peter ist der Initiator, das ursprüngliche ›Solokonzert‹ in eine kollektive musikalische Darbietung zu verwandeln. Das stellt für Franz offensichtlich eine akzeptable Lösung dar: Jedenfalls zeigt er sich in einer späteren Szene des Tages mit seinem Xylophon unterm Arm »entspannt und zufrieden« (vgl. Brandes 2008, S. 9 f.).
Es ist aber auch möglich, dass ganz andere Themen einer Gruppe durch einzelne zur Sprache gebracht werden. So mag ein spezifischer Moment in der Dynamik des Gruppengeschehens, der eine belastende Erinnerung an seine frühe Lebenszeit wachzurufen droht, für ein bestimmtes Kind zum Auslösereiz werden, höchst auffällig zu reagieren. Das wäre sein persönlicher Anteil an der Eskalation. Aber dieses Verhalten repräsentiert unter Umständen auch einen gruppentypischen Aspekt. Dann brächte dieses Kind einen latent schwelenden Konflikt zum Ausdruck – es ›erledigt‹ etwas für die Gruppe, was anders nicht zur Sprache käme. So ließe sich die nach einer Vielzahl von Zurückweisungen abrupt ausbrechende Aggression eines Jungen als der Ärger aller Jungen der Gruppe verstehen, dass die Mädchen von den Erzieherinnen wegen ihres angepassten weiblichen Verhaltens bevorzugt werden (vgl. Finger-Trescher 2012, S. 25 f.). Gehen wir noch eine Stufe ›höher‹, so erkennen wir ein deutliches Wechselspiel von Psychostruktur und Institution (vgl. Schallehn-Melchert 1998, S. 57). Die Institution ist die »Bühne, auf der die Dramen der Kindheit reinszeniert werden« (vgl. Hilleke 1998, S. 26). So sind alle Mitglieder einer Institution in eine »dynamische Matrix wechselseitiger Bemächtigungsversuche eingebunden«, die sich insgesamt zu einer Pyramide von Machtverhältnissen aufschichten. Die Rekonstruktion dieser »Macht-Matrix« landet am Ende beim Individuum, das zwar für sich existiert, aber durch die erlebten Interaktionen mit anderen Individuen vorgezeichnet ist: »Seine individuelle Psyche ist die individualisierte (mentale) Matrix dieser Beziehungen« (vgl. Haubl 2005, S. 55 ff.).
Abschließend sei daher noch einmal Wert gelegt auf die Betonung der institutionellen Rahmung einer entwicklungsunterstützenden Psychoanalytischen Pädagogik, ohne die das Ziel, Pädagogik jenseits normativ gewirkter Übergriffe im Sinne einer leeren Anpassungs- und Erziehungstechnologie zu gestalten, kaum gelingen wird. Dabei sind mehrere Variablen zu beachten: die durchaus sehr unterschiedlichen Klient/innen, das vom Pädagogen/von der Pädagogin zu sichernde Setting, die Person des Pädagogen/der Pädagogin selbst sowie die je spezifischen Arbeitsziele innerhalb der Institution. Hansjörg Becker hat es so auf den Punkt gebracht: »Das Objekt der Übertragung ist die Organisation« (vgl. Becker, H. 1998, S. 94, Gerspach 2018, S. 199 ff.; Gerspach 2020a).
Auch Regina Clos veranschaulicht den Nutzen eines gruppenbezogenen psychoanalytischen Verstehens (vgl. Clos 1991, S. 62 ff.).
In ihrer neuen Klasse einer stationären Sonderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen (zum damaligen Zeitpunkt noch Lernbehindertenschule genannt) sind Kinder im Alter zwischen 8 und 10 Jahren versammelt, die allesamt erhebliche Probleme aufweisen. Sie versucht, mit den Kindern affektiv »mitzuschwingen« und sich in das einzufühlen, was gerade »los« ist. Aber all diese Versuche werden von ihnen anfangs komplett torpediert. Die Kinder sind noch nicht soweit, ihren subjektiven Schutz aufgeben zu können, veranstalten nur ein unbeschreibliches Chaos. In solchen Fällen scheitert selbst der stupideste Unterricht »an der Vehemenz ihrer Aggressionen«. Zwar spüren sie, dass es sich um eine einfühlsame Lehrerin handelt, aber gerade weil Hoffnung aufkommt, werden auch die Ängste wieder wach. An dieser Stelle bezieht sich Clos auf Winnicott, wonach sich ein Kind mit »antisozialen Tendenzen« sogar gegen diese Hoffnung wappnen muss, weil er aus Erfahrung weiß, dass der Schmerz, wenn es diese Hoffnung wieder aufgeben muss, unerträglich ist (vgl. Clos 1991, S. 61; Winnicott 1984, S. 269 ff.; Winnicott 2009, S. 100 ff.).
Dass und wie sich dieser tote Punkt überwinden lässt und ein Dialog einsetzen kann, wird im Fortgang der Geschichte erzählt. Auf dem Schulgelände befand sich ein kleiner Teich, der auf die Kinder eine magische Anziehungskraft ausübte. In jeder Pause trafen sich die Kinder ihrer Klasse dort, turnten im Winter auf dem Eis herum und holten sich trotz Eis und Kälte immer wieder nasse Füße. Zahlreiche Verbote und Ermahnungen vermochten all das nicht zu verhindern.
Nun siedelten sich im Frühjahr dort einige Stockenten an. Natürlich wollten die Kinder sie haben, da sie sich aber nicht fangen ließen, warfen sie in einem unbeobachteten Moment mit Stöcken nach ihnen und trafen eine der Enten, die sich stark blutend ins nahe Gestrüpp rettete. Sie berichteten ihrer Lehrerin davon, und auch die aufsichtführenden Kolleg/innen hatten den Vorfall inzwischen mitbekommen. Entsetzt nahmen sie alle zur Kenntnis, dass die Kinder nicht in der Lage waren, artgerecht mit diesen Tieren umzugehen. Dass man sie nicht wie einen Hund streicheln und auf den Arm nehmen konnte, machte sie so wütend, dass sie sie mit Stöcken bewarfen. Alle eindringlichen und moralischen Appelle stießen bei den Kindern auf taube Ohren. Sie hatten nur sehr geringe oder gar Hemmungen, einem Lebewesen wehzutun.
»Den Kindern fehlte das, was Winnicott die ›Fähigkeit zur Besorgnis‹ nennt, eine schon im ersten Lebensjahr entstehende Basis für die Entwicklung von Vor- und Rücksicht, von der Fähigkeit, Bedenken zu haben, strukturierte Schuldgefühle zu entwickeln oder einen Schaden wieder gut zu machen, kurz, für das eigene Handeln Verantwortung zu übernehmen« (vgl. Clos 1991, S. 63).
Zunächst brachte Clos ihnen Materialien über Stockenten und ihre Lebensweise mit, aber vergebens. Offenbar hatten sie so mächtige archaische Schuldgefühle ausgebildet, dass die Konfrontation mit der Untat ihr Selbstgefühl zu stark bedroht hätte. Trotzdem fragten sie in den folgenden Tagen immer wieder nach, wo denn die verletzte Ente nun sei, ob man sie gefunden und zum Tierarzt gebracht hätte oder ob sie gar gestorben sei. Zum ersten Mal hatte ihre Lehrerin den Eindruck, dass sie über die Folgen ihres Handelns wirklich erschrocken waren. »Die Gruppe schien an einem wichtigen Entwicklungsschritt angelangt. Die Kinder begannen, ihre Umgebung und die Folgen ihres Handelns als solche wahrzunehmen«. Clos versuchte, das so gewachsene Interesse für Tiere wachzuhalten, wobei sie die Verbindung zu ihren massiven Neid- und Rivalitätsgefühlen sowie Versorgungswünschen sicherstellen wollte. »Sie selbst waren noch nicht aus ihrer ›Eischale‹ herausgeschlüpft. Sie erlebten sich noch als Mittelpunkt der Welt und glaubten, über alles und jeden gemäß ihrer spontanen Wünsche auf magische Weise verfügen zu können« (vgl. S. 64). Die Kehrseite dieser Größenphantasie ist die Erfahrung von absoluter Ohnmacht, Hilflosigkeit, unbändiger Wut und unvorstellbarere Angst, und diese Erfahrung erklärt ihren massiven und lang anhaltenden Widerstand, sich auf die Angebote der Lehrerin einzulassen. Wieder mit Blick auf Winnicott befindet Clos, dass die gezeigte Destruktivität ein Zeichen von Hoffnung ist, etwas wiederzufinden, das ihnen verloren gegangen ist – »die Zuverlässigkeit und Berechenbarkeit ihrer Umwelt« (vgl. Clos 1991, S. 66; Winnicott 1990, S. 269 ff.).
Читать дальше