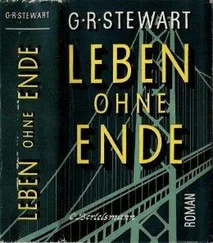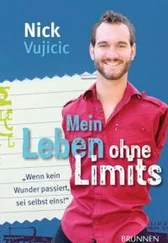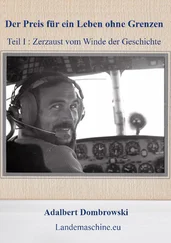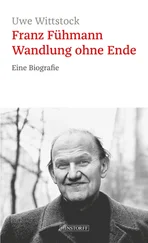»Du kannst dich entspannen«, rät die Schwester, die offenbar die Schweißtropfen auf meiner Stirn bemerkt hat, »die Untersuchung ist ungefährlich und dauert nur ein paar Minuten.«
Ich werde in die enge Röhre geschoben. Sie umschließt mich, nimmt mir die Luft zum Atmen. Ich fühle mich alles andere als entspannt.
»Bitte jetzt nicht mehr bewegen«, sagt die Schwester, und ich erstarre, denke an einen metallenen Sarg, erinnere mich an Gruselgeschichten von lebendig begrabenen Toten. Der Schweiß läuft meine Schläfen hinunter. Ich zähle still die Sekunden, die mir wie Minuten erscheinen. Was, wenn man mich hier drinnen vergisst und ich von alleine nicht mehr heraus kann? Mir fallen Szenen aus James Bond-Filmen ein, in denen scheinbar harmlose medizinische Untersuchungen zu tödlichen Fallen werden. Parallel dazu merke ich, wie ich in Panik gerate. Ich würde am liebsten laut um Hilfe schreien.
Aber dann, so wird mir klar, müsste man mit der Untersuchung noch einmal von vorne beginnen. Alles, nur das nicht, denke ich. Unter Anspannung all meiner Muskel gelingt es mir, die Panik zu unterdrücken. In was für einen verdammten Albtraum bin ich hier geraten?, schießt es mir durch den Kopf.
Am frühen Nachmittag werde ich auf einem Rollbett in den Operationssaal geschoben. Eine Schwester redet mit leiser Stimme auf mich ein, sieht mich an und lächelt. So sehr ich eigentlich beschlossen habe, mich gegen alles hier abzukapseln, bin ich doch spontan froh, ihr freundliches Gesicht zu sehen. Die Angst hat sich seit der Computertomographie weiter ausgebreitet, sitzt in meinem Magen, der Brust, und verschnürt meine Kehle wie ein Band. Die Anästhesistin nimmt meine Hand. Sie erklärt mir, sie wisse aus Berufserfahrung, dass nichts so tröstlich sei, wie die Berührung durch einen anderen Menschen. Na, sie muss es ja wissen. Sanft drückt sie meine Finger. Obwohl ich das unangenehm sentimental und kindisch finde, fühle ich mich tatsächlich ein wenig besser.
Alles wird gut, sage ich mir. Ich habe auf keinen Fall einen Tumor. Ich, der ich immer gesund gewesen bin. Bestimmt sind es Polypen, die den Druck in meinem Kopf und den lästigen Schnupfen verursachen.
Der Professor beugt sich über mich, und als ich sein konzentriertes Gesicht sehe, ist die Angst wieder da, trifft hart wie ein Vollrist-Schuss gegen meine Brust, und ich weiß plötzlich, dass ich nicht mehr zu retten bin.
Ich wache auf und fühle mich wie zerschlagen. Trotzdem bin ich für einen Moment froh, es jetzt hinter mir zu haben. Aber als ich in das kreidebleiche Gesicht meiner Mutter blicke, wird mir sofort wieder klar, dass das nicht das Ende der Geschichte ist. Ich kenne sie zu gut, um nicht automatisch hinter die Fassade von Festigkeit zu blicken, die sie errichtet hat, um mich nicht zu beunruhigen.
Als der Professor mein Zimmer betritt, wird die Stimmung nicht gerade ausgelassener. Es ist beinahe, als wäre ich bereits tot, so bleiern lastet jeder stille Moment auf allen Dingen im Raum. An der Art, wie der Arzt und meine Mutter einander zunicken, erkenne ich, dass sie bereits miteinander gesprochen haben, bevor ich wach geworden bin. Vermutlich haben sie sich darauf verständigt, mir nicht alles, was die Operation zutage befördert hat, ungeschminkt mitzuteilen. Das kann nicht gut sein, denke ich. Andererseits will ich eigentlich auch gar nichts darüber wissen, über den »Verlauf des Eingriffs«, meinen »Zustand«, meine »Prognose«, und wie all die anderen widerwärtigen medizinischen Ausdrücke heißen, die für mich zu alten, sterbenden Omas passen, aber sicher nicht zu mir.
Allerdings fühle ich mich schwach und ausgeliefert. Am liebsten würde ich den Arzt und meine Mutter anschreien, aufspringen und diesen widerlichen Ort verlassen. Aber ich bin körperlich nicht in der Lage dazu. Deshalb beschließe ich, mich auf passiven Widerstand zurückzuziehen. Ich wende mich ab, lasse die Müdigkeit, die ich in mir spüre, die Oberhand über meinen Zorn gewinnen, und drifte in einen Dämmerschlaf ab.
Im Einschlafen überlege ich noch, wann ich wohl wieder zum Training zurückkehren kann. Ich grüble, was ich tun könnte, damit meine Mutter und die Ärzte es mir erlauben. Auch wenn ich innerlich weiß, dass sie es gut mir meinen, sind sie zu meinen Gegnern geworden, die ich überwinden muss, um wieder das Leben führen zu können, das ich will. Ich blinzle noch einmal und präge mir das mich abstoßende Interieur des Krankenhauses, seinen Geruch und seine widerwärtig milden, beruhigenden Farben ein. Wenn ich keine Spieler auf dem Platz bekämpfen kann, dann werde ich eben das hier bekämpfen, denke ich trotzig. Dann ist eben das Krankenhaus mein Gegner.
Als ich nach dem kurzen Erholungsschlaf erwache, ist es Abend. Meine Mutter hat bereits unsere Sachen gepackt. Da es nur ein geringfügiger Eingriff war, darf ich das Krankenhaus noch an diesem Tag wieder verlassen. Das scheint mir ein gutes Zeichen zu sein. Meine Stimmung hellt sich ein wenig auf, während ich das Spitalshemd gegen Jeans und Pullover tausche.
Auf der Heimfahrt kauft meine Mutter an einer Tankstelle ein Feuerzeug und eine Packung Zigaretten. Sie öffnet die Packung mit fahrigen Bewegungen. Die Zigaretten rutschen heraus, fallen zu Boden. Meine Mutter greift nach einer, steckt sie in den Mund und zündet sie an, als wäre sie ein lebensnotwendiges Medikament. Sie hat das Rauchen vor eineinhalb Jahren aufgegeben, wie ich mich sehr genau erinnere. Erst jetzt fällt mir auf, dass meine Mutter krank und gealtert aussieht. Die feinen Fältchen und Linien scheinen sich mit einem Mal tief in ihr Gesicht gegraben zu haben. Ihre Augen sind gerötet, die Tränensäcke geschwollen.
Die Zigarette inhaliert sie in wenigen, intensiven Zügen. Dann schiebt sie mich zurück zum Auto, steigt ein und startet wortlos den Motor.
Am nächsten Tag muss ich zu einer Magnetresonanz-Untersuchung in die Landeshauptstadt St. Pölten. Wie genau meine Mutter es geschafft hat, so schnell den nächsten Untersuchungstermin zu bekommen, ist mir schleierhaft. In jedem Fall ist sie dafür den ganzen Abend am Telefon gehangen. Ich überstehe die Prozedur mit meiner schon im Goldenen Kreuz erprobten Methode des passiven Widerstandes. Meine Mutter scheint das nicht zu stören, solange ich alles mit mir machen lasse, was sie und die Ärzte von mir verlangen.
Danach ist erst einmal Ruhe. Das Nikolaus-Fest steht vor der Tür. Traditionell feiern wir es bei meinen Großeltern, und diese Feier scheint mir der ideale Ort zu sein, um in die Normalität zurückzukehren und den Spitals-Albtraum hinter mir zu lassen.
Es ist früher Nachmittag und noch hell draußen. Als wir Kinder jünger waren, hat sich mein Stiefvater an diesem Tag manches Mal als Nikolaus verkleidet und uns die Jutesäckchen, die mit Mandarinen, Äpfeln, Nüssen, Schokoladekrampussen und Vanillekeksen von Oma gefüllt waren, gegen Vortrag eines kurzen Gedichts überreicht. Schon als ich vier Jahre alt war, habe ich ihn beim Betreten des Hauses an seinen Schuhen erkannt.
Wir sitzen um den großen Esstisch, meine Brüder reden und lachen. Mein Opa spricht über die Fußballsaison, über die Leistungen seiner Lieblingsmannschaft Rapid, beklagt Spritpreise, das immer teurer werdende Service seines Autos und amüsiert sich über meine Geschichten aus dem Internat. Über meine Gesundheit spricht hier niemand, und darüber bin ich heilfroh.
Da mein Opa mich oft zur Schule fährt und ebenso oft zu den Matches begleitet, kennt er die meisten meiner Klassenkollegen und fragt mich gerne über ihre neuesten Streiche und Späße aus. Wenn ich ihm davon erzähle, verändert sich sein Gesichtsausdruck. Er wird weicher und milder und sein spitzbübisches Lachen erinnert mich dann an das eines kleinen Jungen. Die Großmutter will wissen, ob es schon einen Termin für die Weihnachtsfeier im Fußballverein gibt, fragt, ab wann ich und meine Brüder trainingsfrei haben, was die Schule macht und ob im Heim ordentlich gekocht wird. Ich sage, dass das Essen in unserer Kantine nicht annähernd so gut schmeckt wie das ihre, und sie lächelt zufrieden. Mein Stiefvater setzt sich neben meinen Opa, spricht mit ihm über den österreichischen Fußball. Sie diskutieren, ob Rapid es schaffen wird, dieses Jahr den Meistertitel zu holen, sind sich einig, dass das Nationalteam nicht mehr so gut ist und seine Spieler nicht mehr so ehrgeizig sind wie früher.
Читать дальше