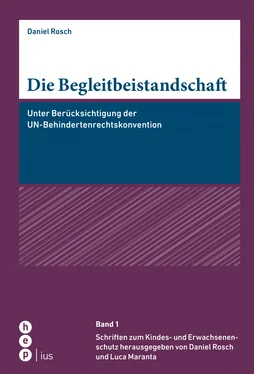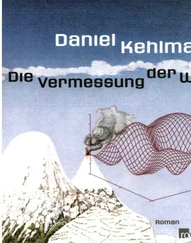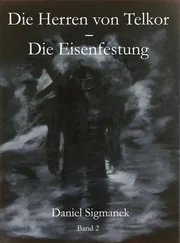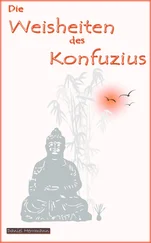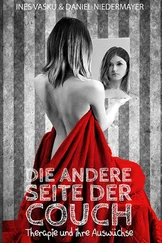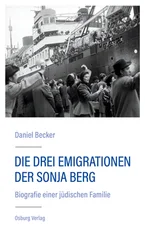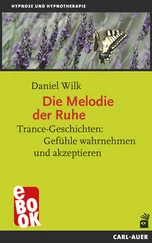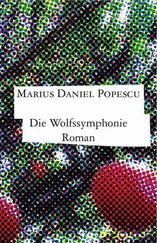44
Die beiden Beistandschaften konnten auch kombiniert werden, wobei in der Praxis vorab die Kombination von Art. 392 Ziff. 1 i.V.m. Art. 393 Ziff. 2 aZGB im Vordergrund stand.[133] Hier umfasste die Vertretungsmacht des Beistandes die gemäss Schutzzweck notwendige Personen- und Vermögenssorge.[134]
45
Die Beistandschaft auf eigenes Begehren erschien prima vista als besonders niederschwellige Massnahme. Das eigene Begehren verwies auf die Freiwilligkeit. Damit war sie in Bezug auf die Initialphase durchaus eine sehr milde Form; betrachtete man demgegenüber ihre Vertretungsmacht, so beinhaltet diese eine umfassende Personen- und Vermögenssorge.[135] Entsprechend orientierte sie sich bereits im Gesetzestext an der Vormundschaft,[136] weshalb auch der Aufgabenumfang von der Vormundschaft hergeleitet wurde[137] und somit die Einkommensverwaltung auch zum Aufgabenbereich des Beistandes gehörte. Eine Besonderheit der Beistandschaft auf eigenes Begehren war, dass die Behörde die Massnahme aufheben musste, sobald die schutzbedürftige Person dies beantragte. Die Behörde hatte aber – allenfalls weiter in die Rechtstellung des Betroffenen reichende – andere Massnahmen zu prüfen.[138]
4.2Die Beiratschaften (Art. 395 aZGB)
46
Bei der Beiratschaft wurde die Beschränkung der Handlungsfähigkeit der schutzbedürftigen Person erforderlich, weil diese aufgrund ihres Schwächezustandes entweder von sich aus mehr oder minder unkontrolliert selbstschädigende Handlungen ausführte oder dazu verleitet wurde. Die Beiratschaften unterteilten sich in die Mitwirkungsbeiratschaft, die Verwaltungsbeiratschaft, die kombinierte Beiratschaft und die Beiratschaft auf eigenes Begehren. Sie zielten alle primär auf die Vermögenssorge ab. Personensorge war aber möglich; diese durfte aber in Bezug auf die Schutzbedürftigkeit nicht Haupt-, sondern nur Nebenwirkung sein.[139]
47
Die Mitwirkungsbeiratschaft gemäss Art. 395 Abs. 1 aZGB beschränkte die Handlungsfähigkeit der schutzbedürftigen Person, indem die in Ziffer 1.–9. aufgeführten Geschäfte in jedem Falle nur gültig zustande kamen, wenn der Mitwirkungsbeirat diesen zustimmte. Er war nicht gesetzlicher Vertreter; die urteilsfähige schutzbedürftige Person musste die Geschäfte vornehmen, und der Beirat konnte diesen nur zustimmen – sei es stillschweigend, explizit, vorgängig oder nachträglich.[140]
48
Bei der Verwaltungsbeiratschaft wurde der schutzbedürftigen Person die Verwaltung über ihr Vermögen mit Ausnahme der Erträgnisse und der Einkommensverwaltung[141] entzogen und dem Beirat in ausschliesslicher Kompetenz übertragen.[142] Damit wurde in diesen Aufgabenbereichen der betroffenen Person gleichzeitig die Handlungsfähigkeit entzogen.[143]
49
Die kombinierte Beiratschaft vereinte die Wirkungen der Mitwirkungs- und der Verwaltungsbeiratschaft. Damit wurde einerseits das Vermögen mit Ausnahme der Erträgnisse und des Einkommens der schutzbedürftigen Person entzogen; auf der anderen Seite zudem die Handlungsfähigkeit der schutzbedürftigen Person in Bezug auf die Erträgnisse und das Einkommen der in Ziffer 1.–9. aufgeführten Geschäfte eingeschränkt.[144]
50
Die Beiratschaft auf eigenes Begehren war keine eigenständige Massnahme, sondern konnte sich auf die Mitwirkungs–, die Verwaltungs- oder die kombinierte Beiratschaft beziehen. Sie wurde analog zu Art. 394, respektive Art. 372 aZGB angewendet. Folge davon war, dass die Voraussetzungen der Massnahme etwas milder beurteilt werden konnten[145] und die Verhältnismässigkeitsprüfung dazu führte, dass bereits bei geringerer Schutzbedürftigkeit eine Massnahme errichtet werden konnte.[146] Im Unterschied zur Beistandschaft auf eigenes Begehren musste dem Antrag der schutzbedürftigen Person auf Aufhebung nicht automatisch entsprochen werden. Analog zur Vormundschaft auf eigenes Begehren galt Art. 439 Abs. 3 aZGB.[147]
4.3Die Vormundschaften (Art. 369–372 aZGB)
51
Die Vormundschaften entzogen der schutzbedürftigen Person die Mündigkeit. Sie war handlungsunfähig; allenfalls war sie beschränkt handlungsunfähig, soweit sie noch urteilsfähig war.[148] Die Rechtsmacht[149] des Vormundes beinhaltete eine umfassende Personen- und Vermögenssorge sowie die Vertretung, wobei hier wiederum die höchstpersönlichen Rechte zu beachten waren.[150] Unterschieden wurden die Entmündigung wegen Geisteskrankheit und Geistesschwäche, diejenige wegen Verschwendung, lasterhaftem Lebenswandel, Trunksucht und Misswirtschaft, wegen Freiheitsstrafe und auf eigenes Begehren. Bei Art. 369 f. aZGB fand sich unter anderem die dauernde Fürsorge- und Beistandsbedürftigkeit als soziale Voraussetzung einer Entmündigung. Damit konnte eine Entmündigung auch im Rahmen der Personensorge erfolgen, und dem Vormund wurden in solchen Fällen insbesondere Aufgabenbereiche der umfassenden Personensorge übertragen.[151]
4.4Die Personensorge im Rahmen der altrechtlichen personengebundenen Massnahmen
52
Zusammenfassend waren bereits im altrechtlichen System vormundschaftliche Massnahmen zur Personensorge punktuell oder relativ ausgeprägt möglich, auch wenn dies nicht immer explizit aus dem Gesetzestext ersichtlich war. Grenze dieser zuweilen kreativen Auslegungen von Lehre und Rechtsprechung zugunsten einer funktionierenden Praxis war, dass mit der Anreicherung der Personensorge nicht ein Rechtsinstitut umgestaltet werden durfte. Eine solche Auslegung begünstigte, dass Personen- und Vermögenssorge nicht trennscharf zu unterscheiden waren und in Wechselwirkungen standen.[152]
5.Fazit: Die Personensorge im rechtshistorischen Rückblick
53
Dieser kurze rechtsgeschichtliche Rückblick hat aufgezeigt, dass unzureichende Vermögenssorge über weite Strecken der Entwicklung ein Grundkriterium des Fürsorgebedarfs war. In dieser Allgemeinheit wurde es zwar erst im Vernunftrecht benannt, findet sich aber de facto bereits im römischen und im gemeinen Recht.[153] Die eigentliche Personensorge entwickelte sich im Erwachsenenschutzrecht als Abbild des Erziehungsgedankens aus der Vormundschaft über Minderjährige und findet erst spät mit dem Zivilgesetzbuch von 1907 ausdrücklich Eingang ins Gesetz. Aber auch das Zivilgesetzbuch von 1907 ist auf Vermögenssorge ausgerichtet und behandelt die Personensorge eher als Nebenerscheinung. Durch Auslegung wurde aber das typenfixierte und –gebundene Massnahmensystem mit Personensorge angereichert – gerade auch deshalb, weil eine Wechselwirkung zwischen Personen- und Vermögenssorge besteht bzw. die beiden Bereiche nicht trennscharf voneinander abgegrenzt werden konnten.
54
In Bezug auf den Schutzzweck zeigt sich, dass ursprünglich vorab Interessen der Familien, Dritter und der Allgemeinheit mindestens mitentscheidend für die Anordnung einer Massnahme waren. Diese Fremdinteressen blieben trotz der zunehmenden Ausrichtung auf das Wohl der hilfs- und schutzbedürftigen Person über weite Strecken auch noch bis in das Zivilgesetzbuch von 1907 spürbar.[154]
6.Die Entwicklung des Begriffs der Personensorge im Vormundschaftsrecht und im revidierten Erwachsenenschutzrecht
6.1Die Personensorge
55
Der Gedanke der Fürsorge ist im Kern dem öffentlichen Recht zuzuordnen. Trotzdem finden sich – vor allem im Familienrecht – fürsorgerische Überlegungen durchaus auch im Privatrecht, wo gerade im Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzes dem Staate fürsorgerische Aufgaben zukommen.[155] Die persönliche Fürsorge bzw. die Personensorge als eigenständiger Teil der erwachsenenschutzrechtlichen Tätigkeit hat sich – wie oben aufgezeigt[156] – aus dem Kindesrecht und hier insbesondere der Vormundschaft über Minderjährige herauskristallisiert.[157]
Читать дальше