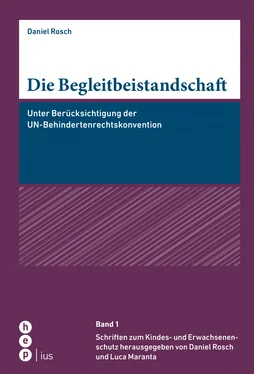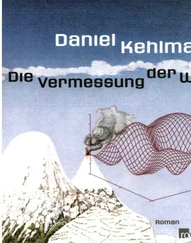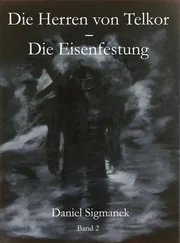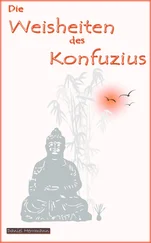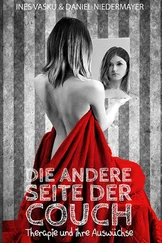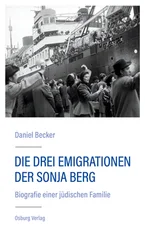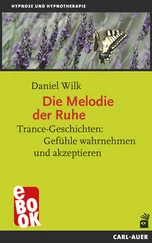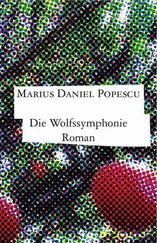35
Dieser Tendenz stellt sich zunächst eine naturrechtliche Bewegung entgegen, die im Sinne der Rechtsgleichheit Veränderungen zugunsten von Frauen, ausserehelichen Kindern und anderer Diskriminierungen anstrebt und teilweise auch erwirkt.[106] Die Französische Revolution und insbesondere der davon geprägte Code Civil vermag die Staatsallmacht im Vormundschaftsrecht sodann zu beschränken.[107] Zugleich wird der Code Civil zum Vorbild für andere Länder, auch für einzelne Schweizer Kantone.[108] Der Code Civil, aber auch später das Vormundschaftsrecht des Privatrechtlichen Gesetzbuches für den Kanton Zürich vermögen das Spannungsverhältnis zwischen Familieninteressen und staatlicher Ordnung für diese Zeit auszutarieren.[109]
36
Im 19. Jahrhundert regeln viele Kantone das Vormundschaftsrecht in eigenständigen Erlassen, wobei sich die frankophone Schweiz am Code Civil, der Kanton Bern am österreichischen ABGB orientiert.[110] Gerade die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts steht unter dem Einfluss von liberalen Ideen, wendet sich von der «Reglementierungssucht des Polizeistaates»[111] mehr oder minder ab und verweist den Staat in die Rolle des subsidiären Helfers.[112] Das Bundesgesetz betreffend die persönliche Handlungsfähigkeit vom 22. Juni 1881 bringt eine erste Vereinheitlichung mit sich. Art. 5 des Gesetzes legt erstmals die Entmündigungsgründe für die ganze Schweiz fest (Verschwendung, geistiges bzw. körperliches Gebrechen, Misswirtschaft, Strafgefangenschaft, eigenes Begehren). Zudem ist auch eine lediglich teilweise Beschränkung der Handlungsfähigkeit möglich.[113] Folge davon ist, dass mit der Beschränkung der Anzahl der Entmündigungsgründe die persönliche Freiheit faktisch gestärkt wurde, wenn auch der historische Gesetzgeber eher den Rechtsverkehr mit schutzbedürftigen Personen vereinheitlichen und sichern wollte.[114]
37
Im 20. Jahrhundert treten zu dieser liberalen Haltung noch sozialstaatliche und –politische Ziele hinzu, und zwar gerade dort, wo infolge der Industrialisierung die Familie ihren Aufgaben nicht mehr nachzukommen vermag.[115]
38
Das massgeblich von Eugen HUBER geprägte geltende Zivilgesetzbuch von 1907 basiert im Wesentlichen auf den vor Inkrafttreten des ZGB geltenden kantonalen Ordnungen. Dort finden sich bereits in Bezug auf die Personensorge gerade in den Kantonen Bern und Graubünden entsprechende Bestimmungen, die Gebrechlichen eine anständige Verpflegung und in Graubünden, soweit tunlich, eine heilende Pflege zuteilwerden lassen; zudem sind Verschwender zu einer «verständigen und geordneten Lebensweise anzuhalten.»[116] Die Leistung von Eugen HUBER ist in diesem Bereich insbesondere in «der Sichtung und straffenden Synthese der schier unübersehbaren kantonalen Stofffülle»[117] zu sehen. Dennoch ist das Vormundschaftsrecht durch das neue Zivilgesetzbuch einem inneren Wandel ausgesetzt. Dieser liegt in seiner sozialen Ausrichtung und seiner fürsorgerischen Zielsetzung. Zwar war es im kantonalen Recht bereits so, dass dem Vormund Aufgaben der Personensorge übertragen wurden.[118] Im Kindesrecht hat das ZGB sie aber in den Vordergrund gestellt und erweitert. Diese Tendenz ist auch im Vormundschaftsrecht ersichtlich: Die Formulierung der Entmündigungsgründe zeigt deutlich das verstärkte Bedürfnis nach vermehrter Personensorge.[119] Hintergrund hierfür sind der Wandel in den Wertvorstellungen und die sozialen Umstände, insbesondere die Not in jener Zeit.[120] Dies findet sich im alten Vormundschaftsrecht im Rahmen des Programmartikels von Art. 367 aZGB, aber auch konkretisiert in Art. 406 aZGB, welche die Personensorge auf den Schutzzweck beschränkte.[121] So kann die Aufgabe des Mandatsträgers so weit reichen, dass ihm eine umfassende Betreuung zukommt, welche durchaus vergleichbar mit derjenigen von minderjährigen Personen ist.[122] Im Vergleich zu Normdichte und –gehalt in Bezug auf die Vermögenssorge oder die Vertretung im Rechtsverkehr verbleiben die Bestimmungen über die Personensorge im Zivilgesetzbuch von 1907 dennoch eher bescheiden.[123]
4.Die behördlichen Massnahmen des früheren Vormundschaftsrechts im Überblick
39
Das Vormundschaftsrecht kannte als Hauptmassnahmen die Beistandschaften, die Beiratschaften, die Vormundschaften und die nicht amts- und personengebundene fürsorgerische Freiheitsentziehung. Anknüpfungspunkt war in Bezug auf die personen- und amtsgebundenen Massnahmen die faktische oder rechtliche Einschränkung der Handlungsfähigkeit, in Bezug auf die fürsorgerische Freiheitsentziehung, die Bestimmung über den Aufenthalt gegen den – allenfalls auch mutmasslichen oder hypothetischen – Willen der betroffenen Person und die Unterbringung in einer geeigneten Anstalt. Diese Bestimmung über den Aufenthalt hat – ähnlich der Begleitbeistandschaft[124] – keine Einschränkung der Handlungsfähigkeit zur Folge, stellt aber dennoch einen massiven Grundrechtseingriff dar. Das Abweichen vom sonst üblichen Anknüpfungspunkt der Beschränkung der Handlungsfähigkeit ist historisch zu erklären. Die fürsorgerische Freiheitsentziehung fand erst 1981 Eingang ins Gesetz; zuvor war die Regelung auf Bundesebene sehr lückenhaft.[125] Ihre Vorläufer sind die kantonal geregelten administrativen Versorgungen. Aufgrund der inhaltlichen Nähe zum Eingriffssozialrecht[126] wurde die fürsorgerische Freiheitsentziehung dem Erwachsenenschutz zugeordnet.
40
Die amts- und personengebundenen Massnahmen unterschieden sich dadurch, dass bei den Beistandschaften die Handlungsfähigkeit zwar tatsächlich, aber nicht rechtlich eingeschränkt wird, indem sich die verbeiständete Person die Handlungen des Beistandes anrechnen lassen muss, bei den Beiratschaften diese eingeschränkt und bei den Vormundschaften die Handlungsfähigkeit entzogen wird, wobei die höchstpersönlichen Rechte jeweils im Regelfalle nicht beschränkt werden durften. Im Folgenden werden ausschliesslich die amts- und personengebundenen Massnahmen dargestellt.
4.1Die Beistandschaften (Art. 392–394 aZGB)
41
Die Beistandschaften wurden unterteilt in Vertretungs–, Verwaltungs– und kombinierte Beistandschaft sowie die Beistandschaft auf eigenes Begehren. Allen war gemeinsam, dass der Beistand in Bezug auf die Vertretungsmacht konkurrierende Kompetenzen hatte. Die schutzbedürftige Person und die Beistandsperson konnten handeln; die schutzbedürftige Person musste sich aber die Handlungen des Beistandes anrechnen lassen, weshalb die Handlungsfähigkeit faktisch eingeschränkt war.[127] Voraussetzung für Beistandschaften war in aller Regel eine gewisse Kooperationsfähig- und –willigkeit der betroffenen Person; im Minimum durfte diese die Handlungen der Beistandsperson nicht durchkreuzen oder vereiteln.[128]
42
Die Vertretungsbeistandschaften wurden gemäss den Voraussetzungen in Art. 392 aZGB angeordnet. Darunter fielen insbesondere Interessenkollisionen und Vertretung in dringenden Angelegenheiten. Auch wenn sie nur als vorübergehende Massnahme gedacht waren, konnten sie – aufgrund von Auslegung – auch als Dauermassnahme und sogar zur persönlichen Fürsorge errichtet werden.[129]
43
Die Verwaltungsbeistandschaft des Art. 393 aZGB fokussiert demgegenüber Situationen, in denen eine Person aufgrund eines Schwächezustandes nicht ausreichend um ihr Vermögen besorgt sein konnte. Die Vertretungsmacht des Beistandes leitete sich gemäss den abschliessend aufgezählten vier Situationen von diesen ab. Dabei war der Beistand nur für das Vermögen und nicht für die Einkommensverwaltung zuständig;[130] er war diesbezüglich allenfalls auch Vertreter der schutzbedürftigen Person.[131] Eine beschränkte persönliche Fürsorge mit dem Ziel der Vermögensverwaltung war zulässig, wobei Zwangsmassnahmen ausgeschlossen waren.[132]
Читать дальше