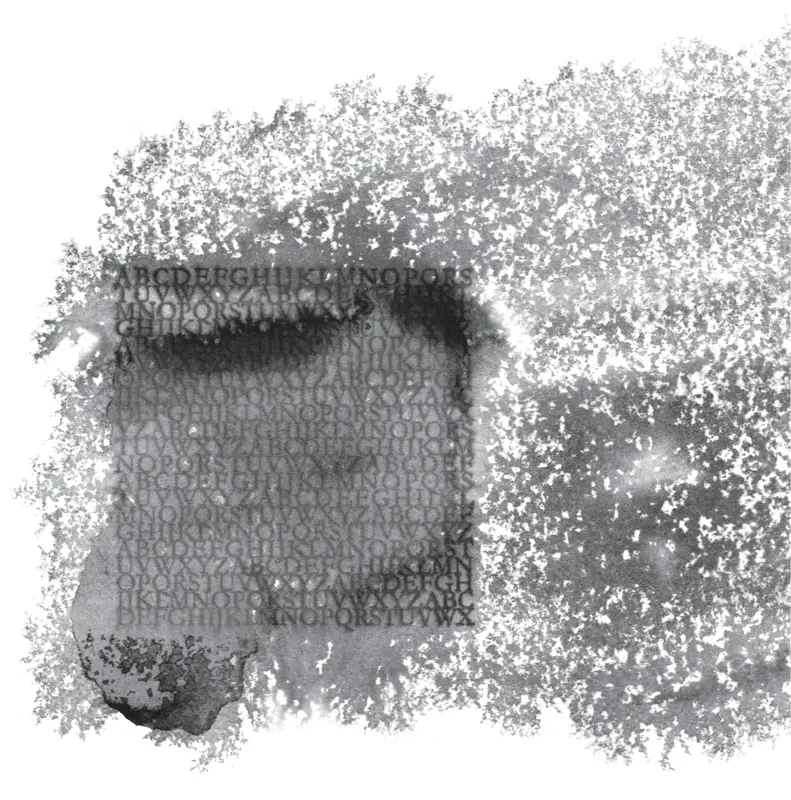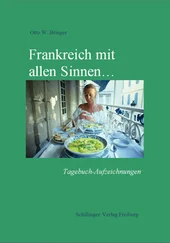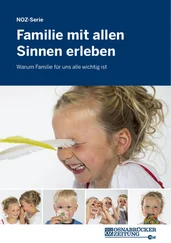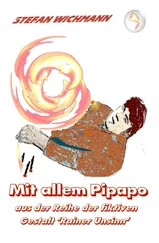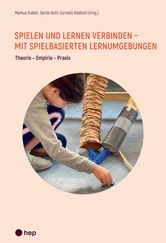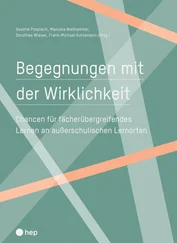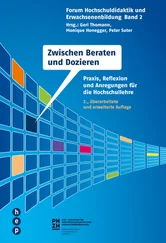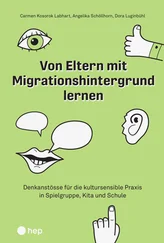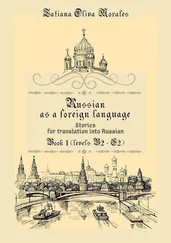Ursula Bertram fokussiert in ihrem Beitrag zu nonlinearem Denken das notwendige Zusammenspiel von Improvisationskraft, Erfindungsgabe und Probierbewegungen.
Eine hochschuldidaktische Denkbewegung, die weg von bestehenden Curricula hin zu Formen für ein anderes Bildungsframework führt, das improvisierendem Lernen Raum eröffnet und dessen Relevanz aufzeigt, macht Wanja Kröger in seinem Essay.
Die Studentin Natascha Kuhn beschreibt in ihrem Erfahrungsbericht aus Studierendenperspektive, wie Improvisieren Räume für hochschulisches Lernen eröffnen kann.
Erinnerungen an improvisierende Lernerfahrungen an Hochschulen und mögliche Formen von Improvisieren aus Dozierendensicht reflektiert Mathis Kramer .
Christopher Dell schliesslich stellt sich der Frage, welches emanzipatorische Potenzial Improvisation birgt.
Improvisationskompetenz müsste sich charakterisieren und feststellen lassen können, so die Arbeitshypothese von Bernhard Suter. Mit seinem Impro-Spyder bietet er eine Möglichkeit an, das Unfassbare in sechs Dimensionen zu erfassen.
Jazzagogik nennt Rolf Kuhn das von ihm unter anderem aus den Praxen des Jazz abgeleitete Verfahren, das Kreieren und eben auch Improvisieren in denkenden Gruppen ermöglicht.
Sandra Wilhelm schliesslich rundet den Band als Leserin aller Beiträge ab und zieht ihre Folgerungen für ihre weitere Tätigkeit als Erwachsenenbildnerin und Dozentin und stellt sich neuen Fragen.
Der Band fokussiert auf ergänzende Handlungsgrundlagen – auf den ersten Blick scheinbar konträr zum rational-logisch geplanten Vorgehen: situative Gefühle, das Antizipieren von Ereignissen, das Assoziieren vorangegangener Erfahrungen, das Spielen und Rütteln an vermeintlich Festgelegtem sowie die Fantasie als zentrale Komponenten der Handlungsregulation.
Gegenstimmen und Contra-Argumente sollen es Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, in Ihrem «Hin- und Herdenken» ermöglichen, eine Position zu finden. Diese finden sich als kurze prägnante und kernige Sätze zwischen den jeweiligen Beiträgen. Auf unsere Bitte hin formulierten die folgenden Kolleginnen und Kollegen kurze Gegenpositionen, die nicht unbedingt ihrer persönlichen Überzeugung entsprechen: Daniel Ammann, Nadine Bieker, Matthias Briner, Dagmar Engfer, Anja Friderich, Erik Haberzeth, Simone Heller-Andrist, Walter Mahler, Jürg Schwarz und Katrina Welge.
Die künstlerische Umsetzung des Themas «Improvisieren» in der Bildungsarbeit obliegt Sarah Burger . Ihre Grafiken (auch auf dem Titelbild) finden sich jeweils neben den Gegenstimmen («Weather, Words», 2020).
Herzlichen Dank unserer Reflexions- und Begleitgruppe während unserer Jubiläumsaktivitäten im Jahre 2019 für etliche Anregungen: Tamara De Vito, Dagmar Engfer, Wanja Kröger, Mira Sack und Beni Suter.
Arn, Christof (2016). Agile Hochschuldidaktik. Weinheim: Beltz Juventa.
Bauman, Zygmunt (1995). Moderne und Ambivalenz. Frankfurt am Main: Hamburger Edition.
Beck, Ulrich (2003). Risikogesellschaft – auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt: Suhrkamp.
Bomann, Jennifer & Yeo, Michelle (2019). Exploring and learning from failure in facilitation. In: International Journal for academic development. Online: www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1360144X.2019.1700120.
Bormann, Hans-Friedrich et al. (Hrsg., 2010). Improvisieren – Paradoxien des Unvorhersehbaren. Bielefeld: Transcript.
Danner, Stefan (2001). Erziehung als reflektierte Improvisation. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
Dell, Christopher (2002). Prinzip Improvisation. Kulturwissenschaftliche Bibliothek, Band 22. Köln: Verlag Walther König.
Dell, Christopher (2012). Die improvisierende Organisation – Management nach dem Ende der Planbarkeit. Bielefeld: Transcript.
Dell, Christopher (2017). Technologie der Improvisation. In: W. Stark et al. (Hrsg.), Improvisation und Organisation. Bielefeld: Transcript, S. 131–141.
Dufourmantelle, Anne (2018). Lob des Risikos – Ein Plädoyer für das Ungewisse. Berlin: Aufbau Verlag.
Dick, Andreas (1996). Vom unterrichtlichen Wissen zur Praxisreflexion: Das praktische Wissen von Expertenlehrern im Dienste zukünftiger Junglehrer. 2. Auflage. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
Kaden, Christian (1993). Des Lebens wilder Kreis – Musik im Zivilisationsprozess. Kassel: Bärenreiter Verlag.
Kunert, Sebastian (2016). Failure Management – Ursachen und Folgen des Scheiterns. Berlin, Heidelberg: Springer Gabler.
Luhmann, Niklas (2002). Das Erziehungssystem der Gesellschaft. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Neumer, Judith (2012). Entscheiden unter Ungewissheit – Von der bounded rationality zum situativen Handeln. In: F. Böhle et al. (Hrsg.), Management von Ungewissheit. Bielefeld: Transcript, S. 37–68.
Paseka, Angelika, Keller-Schneider, Manuela & Combe, Anno (2018). Ungewissheit als Herausforderung für pädagogisches Handeln. Wiesbaden: Springer VS.
Präview, Zeitschrift für innovative Arbeitsgestaltung und Innovation 1/2014: Improvisation in Kunst, Organisation und Gesellschaft. Dortmund.
Rühle, Hermann (2004). Die Kunst der Improvisation. Mit Überraschungskompetenz das Unvorhergesehene meistern. Paderborn: Junfermann.
Schiefner-Rohs, Mandy (2019). Scheitern als Ziel – Ambivalenzen forschungsorientierter Lehre im Studiengang. In: G. Reinmann et al. (Hrsg.), Forschendes Lernen in der Studieneingangsphase. Hamburg: Springer VS, S. 79–91.
Sauer, Johannes & Trier, Matthias (2012). Ungewissheit und Lernen. In: F. Böhle & S. Busch (Hrsg.), Management von Ungewissheit. Bielefeld: Transcript, S. 257–278.
Sieber, Peter (2018). Autorenschaft und Ästhetik – Abwesende in der Schreibdidaktik? Online: zeitschrift-schreiben.ch
Thomann, Geri (2017). Kompetenzorientierung und Bildung auf Tertiärstufe: Drei unterschiedliche Sichtweisen. In: Case Management 4/2017, S. 148–151.
Weick, Karl. E. & Sutcliffe, Kathleen (2016). Das Unerwartete managen. 3. Auflage. Stuttgart: Schäffer-Poeschel.
Zanetti, Sandro (Hrsg., 2014). Improvisation und Invention – Momente, Modelle, Medien. Zürich: diaphanes.
Improvisation legitimiert nachträglich selbst verschuldete Pannen.
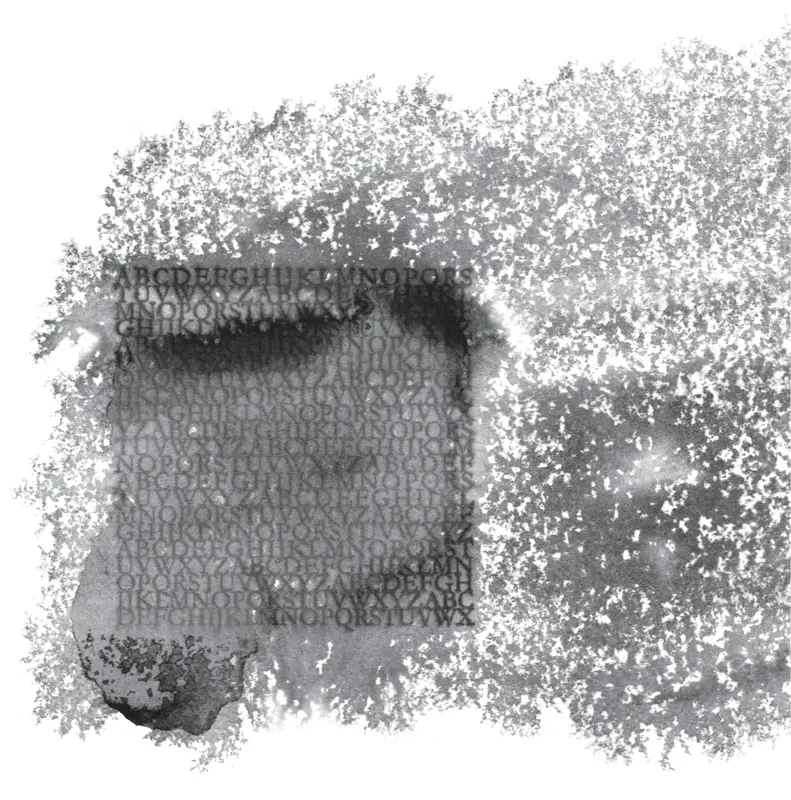
Theo Wehner und Geri Thomann
Über den Geltungsbereich improvisierenden Handelns[1]
Gut ist der Vorsatz,
aber die Erfüllung schwer.[2]
Menschen planen, handeln und improvisieren (auch)
… am besten war ich, wenn ich improvisierte.
In einer Weiterbildung mit Dozierenden zum Fehler- und Konfliktmanagement ging es um die Voraussetzungen und um die Bewältigung von Fehlern. Die Dozierenden waren sich einig, dass unter anderem fehlende Ressourcen und Gründlichkeit bei der Vorbereitung eine der häufigsten subjektiv wahrgenommenen Fehlerquellen für einen nicht gelungenen Unterricht darstellen. Als wir den Umgang mit Fehlern, Pannen, Irrtümern oder nicht vorher bedachten Störungen im Unterricht reflektierten, gab es viele interessante, meist individuelle Erfahrungsberichte, aber letztlich keinen gemeinsamen Nenner. Eindrücklich war für den Erstautor des Textes die in einem späteren Gespräch selbstbewusste Aussage eines Dozenten: «Am besten war ich, wenn ich improvisierte …» Obwohl dieser Dozent meine kopfnickende Zustimmung erfuhr, schob er unmittelbar nach: «… natürlich ging das nur, wenn ich auch gut vorbereitet war.» Damit ist der Dreiklang benannt, um den es im Folgenden geht: (gründliche) Vorbereitung – (unerwartete) Störung – (selbstsichere) Improvisation.
Читать дальше