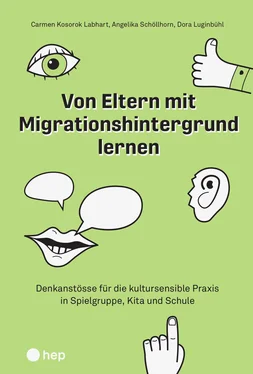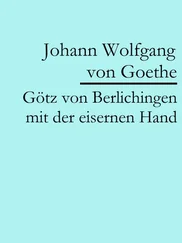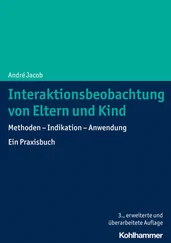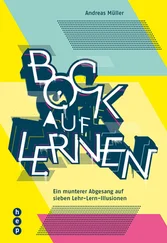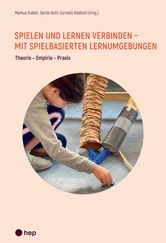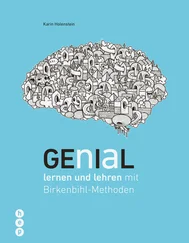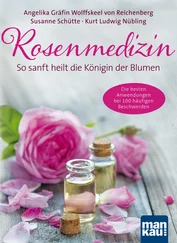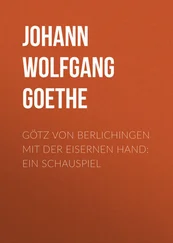Um gerade in schwierigen Ausgangslagen eine konstruktive Kooperation mit den Eltern zu ermöglichen, schlagen Uehlinger und Kolleginnen (2014) eine Selbstreflexion in Bezug auf die eigenen Gefühle und Gedanken, die eigenen Wertvorstellungen und Bedürfnisse sowie den sich anschliessenden Perspektivwechsel zu den Eltern vor. Das gilt für alle oben genannten Beteiligten und setzt nicht voraus, alles über die Kulturen der Kinder zu wissen, mit denen wir arbeiten. «Jede neue Situation erfordert Strategien, um Wissen und Kenntnisse zu erlangen und Handlungsweisen für diese Situation zu entwickeln. Die entscheidende Herausforderung ist, offen zu bleiben, um von den Familien zu lernen» (ebd.) und ihnen mit Interesse, Neugier und Offenheit zu begegnen.
In den folgenden Kapiteln finden Sie eine Fülle von Anregungen. Wir sind uns bewusst, dass diese nicht alle umgesetzt werden können. Es geht darum, sich dazu anregen zu lassen und eine Auswahl zu treffen für die nächsten kleinen Schritte in der jeweils eigenen beruflichen Praxis.
Wie ist das Buch zu lesen?
Das vorliegende Buch basiert auf Interviews mit Eltern mit Migrationshintergrund. Wir haben sie zu ihrer Sicht auf die soziale Integration und die Bildungsentwicklung ihrer Kinder befragt. Entsprechend steht bei allen Aussagen die Perspektive der Eltern im Mittelpunkt, woraus eine individuell geprägte Sicht auf die dargestellten Themen resultiert. Insbesondere bei Themenfeldern wie «Diskriminierung» sind die gebündelten Erfahrungen der Eltern gerade nicht ausgewogen, sondern subjektiv. Das kann auf den ersten Blick zu einer inneren Abwehr führen, weil Leserinnen und Leser vielleicht viele andere Beispiele im Kopf haben. Dennoch möchten wir Sie einladen, das Erleben der Eltern auch an diesen Stellen an- und ernst zu nehmen und sich damit auseinanderzusetzen. Das gegenseitige Verständnis ist der erste Schritt, um gemeinsame Ziele zu entwickeln und zu erreichen.
Bei der näheren Auseinandersetzung mit den Themenfeldern zeigt sich an etlichen Stellen, dass Eltern mit Migrationshintergrund mit denselben Themen beschäftigt sind, mit denen sich auch Eltern ohne Migrationshintergrund auseinandersetzen. Dazu gehören beispielsweise die Auseinandersetzung mit den Betreuungsmöglichkeiten in der frühen Kindheit oder die schulischen und beruflichen Wahlmöglichkeiten im Jugendalter. Wir haben diese Themen absichtsvoll mit aufgenommen. Sie weisen vor allem darauf hin, dass Eltern mit Migrationshintergrund trotz einiger spezifischer Herausforderungen nicht grundsätzlich anders sind als alle anderen Eltern.
Für die Nutzung des Buches sind wir eher von einem Nachschlagewerk und weniger von einer durchgehenden Geschichte ausgegangen. Die Konzeption ist so angelegt, dass eine rasche Orientierung möglich ist und dass, je nach aktuellem Interesse, auch einzelne thematische Schwerpunkte isoliert gelesen werden können. Jedes Kapitel ist für sich allein verständlich, beinhaltet jedoch Querverweise auf andere, thematisch angrenzende Kapitel (→ Themenfeld « Verunsicherung versus Selbstwirksamkeit » ) .
Zu Beginn finden Sie eine alphabetische Übersicht über die zwölf dargestellten Themenfelder. Sie alle sind aus der Sicht von Eltern mit Migrationshintergrund in Bezug auf die soziale Integration und Bildungsentwicklung ihrer Kinder wichtig. Nach diesem ersten Überblick werden die einzelnen Themenfelder, ebenfalls in alphabetischer Reihenfolge, kapitelweise ausgeführt. Hier soll das Spektrum der Denk-, Erlebens- und Verhaltensweisen der Eltern mit Migrationshintergrund aufgezeigt werden und Denkanstösse für die eigene Auseinandersetzung auf der Suche nach Möglichkeiten zur gelingenden Zusammenarbeit gegeben werden. Dabei orientieren sich unsere Ausführungen an folgenden Fragen bzw. Themen:
Das einleitende Originalzitat aus unseren Interviews stimmt auf das Thema ein und bringt das Erleben der Eltern mit Migrationshintergrund prägnant zum Ausdruck. Gleichzeitig führt es von der Sicht der Eltern zu den fachlichen Erläuterungen. Neben der Klärung, was mit dem jeweiligen Themenfeld gemeint ist, finden Sie hier vor allem Informationen, die verdeutlichen, warum dieses Themenfeld bedeutsam ist. Wir haben dazu Fachliteratur einbezogen und richten den Blick auf den aktuellen Diskurs zu diesem Thema in Praxis und Forschung. Hierbei gibt es Themenfelder wie beispielsweise «Sprache», zu denen umfassende Fachliteratur zur Verfügung steht. Andere Themenfelder wie «Information» wurden dagegen bisher kaum wissenschaftlich beleuchtet und zeigen folglich neue Aspekte im Hinblick auf die soziale Integration und Bildungsentwicklung von Kindern mit Migrationshintergrund auf. In der Folge ergeben sich daraus unterschiedliche Qualitäten der Kapitel.
Was erleben Kinder unterschiedlicher Altersstufen und ihre Eltern in Alltagssituationen?
Zu Beginn dieses Abschnitts fassen wir die unterschiedlichen Facetten des Erlebens zusammen, wie Eltern mit Migrationshintergrund sie uns in den Interviews geschildert haben. Dabei wird erkennbar, dass es ein grosses Spektrum an Erlebensweisen gibt, für die es sicher nicht die eine Lösung gibt. Mit der breiten Darstellung des Spektrums, das auch Widersprüche beinhalten kann, wollen wir Sie als Leserinnen und Leser anregen, sich auf eine differenzierte Sichtweise einzulassen, um in einem nächsten Schritt passgenaue Ansätze für die Zusammenarbeit entwickeln zu können.
Weiterhin werden in diesem Abschnitt beispielhafte Situationen unterschiedlicher Altersstufen (frühe Kindheit, Kindergarten/Primarschule, Sekundarstufe) farblich markiert dargestellt. Die Beispiele wurden von den interviewten Eltern ausführlich geschildert und von uns verdichtet dargestellt. Wir haben eine Auswahl an typischen Situationen getroffen und kommentieren in den folgenden Absätzen, was die jeweilige Situation bedeutet und wie in der Praxis damit umgegangen werden kann. In der Auseinandersetzung mit den Beispielen wird deutlich, dass die geschilderten Sequenzen oft mehrere Themenfelder berühren. Sie können daher selbstverständlich auch unter anderen Perspektiven reflektiert und diskutiert werden.
Denkanstösse und Anregungen für die Praxis
In diesen Abschnitten werden keine konkreten Tipps gegeben, da sie den unterschiedlichen Erlebensweisen der Eltern niemals vollumfänglich gerecht werden könnten. Stattdessen werden Reflexionsfragen zu den einzelnen Themenfeldern angeboten. Sie können Fachpersonen aus der Praxis anregen, den jeweiligen Einzelfall und die jeweilige Situation genauer zu beleuchten. An manchen Stellen können diese Fragen knapp mit Ja oder Nein beantwortet werden. Auch in diesen Fällen möchten wir Sie darüber hinaus zu einer weiteren Reflexion einladen, z. B. darüber, warum Sie diese Frage so beantworten.
Damit der Transfer in die Praxis erleichtert wird, haben wir die Anregungen zur Reflexion mit Umsetzungsideen ergänzt. Diese sind teilweise aus unseren Erfahrungen entstanden und teilweise von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Praxisweiterbildungen oder Vorträgen entwickelt worden. Immer wieder werden in diesen Umsetzungsideen spezifische Altersstufen in den Blick genommen, was jedoch die Anpassung an andere Stufen nicht ausschliesst.
Der gesamte Abschnitt richtet sich, wie auch das gesamte Buch, einerseits an Mitarbeitende, andererseits an Leitungen und Träger von pädagogischen Einrichtungen. Auch Eltern mit und ohne Migrationshintergrund werden das Buch mit Interesse und Gewinn lesen, sich darin wiederfinden und zu weiterführenden Gedanken angeregt werden. Da im institutionellen Kontext alle Ebenen der Organisation an der Entwicklung der Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund beteiligt sind, haben wir sie in den Denkanstössen und den Anregungen für die Praxis entsprechend berücksichtigt. Selbstverständlich sind weder die genannten Reflexionsfragen noch die aufgeführten Umsetzungsideen damit erschöpfend behandelt. Gerne laden wir Sie ein, weitere Ideen zu entwickeln.
Читать дальше