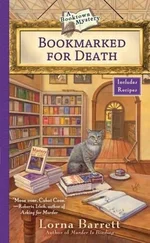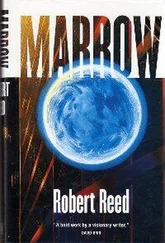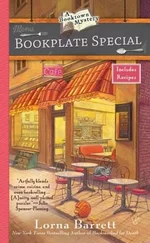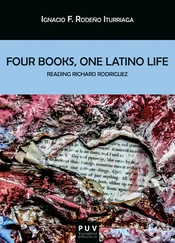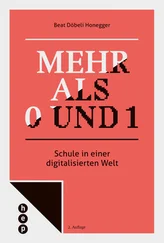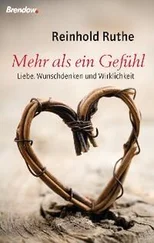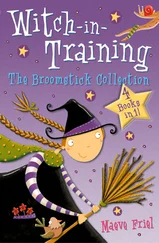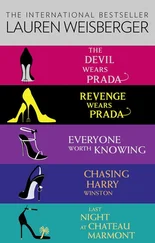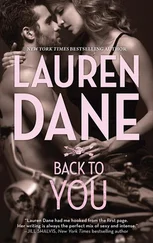•Gemachte Fehler werden wohlwollend aufgegriffen, und es werden daraus lernförderliche Überlegungen und richtige Lösungen abgeleitet (siehe auch Kapitel 8).
•Die Lehrperson wechselt flexibel zwischen ihren Rollen als Wissensvermittlerin, Lerncoach, Beraterin, Ermunternde, Fördernde, Kontrollierende usw., je nach Lernsituation (siehe auch Kapitel 10 und 11).
Fazit
Wenn Erwachsene in Weiterbildungen kommen, um zu lernen, dann haben sie hohe Erwartungen. Diese Erwartungen treffen auf die Erwartungen der Lehrperson, was in dieser Weiterbildung passieren soll. Abhängig von Institution und Bildungssystem, hat die Lehrperson unterschiedliche Möglichkeiten, das Lernklima zu gestalten.
Weiterführende Literatur
Langmaack B./Braune-Krickau M.: Wie die Gruppe laufen lernt.

Kapitel 3
Was hat das Lernen mit der Biografie zu tun?
«Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.»
Henry Ford
Worum es in diesem Kapitel geht
Erwachsene in der Weiterbildung bringen bereits viele Schul- und Lernerfahrungen mit. Als Lehrperson steht man somit Teilnehmenden gegenüber, die über ganz individuelle, erlebte, tradierte, kulturelle Vorstellungen verfügen von «Schule», «Lernen», «Lehrer» usw. Wenn diese Erfahrungen auf diejenigen der Lehrperson treffen, können erheiternde oder auch schwierige Situationen entstehen. Eine Kursleiterin in einem Erwerbslosenkurs erzählt beispielsweise Folgendes:
«Ich fordere die Teilnehmenden auf, ihre Meinung zum gerade vorgestellten Thema zu äussern. Ein junger Mann ausländischer Abstammung teilt sich umgehend mit, bevor er aber zum zweiten Satz kommt, wird er ganz heftig unterbrochen von einem älteren Mann mit gleichem Herkunftsland, der ihn anraunzt: Sei doch einfach still, wenn die Lehrerin redet! Und dann schaut dieser mich erwartungsvoll an, um von mir Anerkennung für seine Unterstützung für mich zu erhalten.»
Viele Lehrpersonen scheuen sich, spielerische oder persönlichere Methoden einzusetzen, weil sie glauben, dass ihre erwachsenen Lernenden dies nicht schätzen würden. Dieser Annahme liegen aber meistens eigene fixe Vorstellungen und tradierte Bilder von Unterricht und Lehrerrolle zugrunde, und sie wurde Ü nicht mit der Erfahrung mit mehreren Lerngruppen abgeglichen.
Die Erfahrungen der Personen, die an einer Weiterbildung beteiligt sind, sind in vierfachem Zusammenhang wirksam:
•als Erwartungen der Lernenden und Lehrenden, dass der Unterricht so statt-zufinden habe, wie sie sich eine gute Weiterbildung vorstellen bzw. wie sie sie früher als gut erlebt haben;
•als Ängste der Lehrenden und Lernenden, dass der Unterricht wieder so werde wie damals in der Schule;
•als bevorzugter Lehrstil von Lehrpersonen, weil sie selbst schon auf diese Art und Weise am besten gelernt haben;
•als eingeschränktes Methodenrepertoire, weil die Lehrperson auf diejenigen Methoden zurückgreift, die sie selbst – teilweise vor langer Zeit – erlebt hat, und weil sie neuere Vorgehensweisen gar nicht in Erwägung ziehen kann.
Das Thema «Lernen» weckt bei Erwachsenen zwangsläufig Erwartungen und Ängste, da die Lernenden (ebenso wie die Lehrpersonen) nur zu gerne in alte Muster verfallen.
In diesem Kapitel wird aufgezeigt, wie das Gedächtnis funktioniert und welche Wahrnehmungskanäle aktiv sind. Wir erkennen, wie unser Erfahrungsschatz mit jeder Lehr- und Lernsituation wächst. Daraus entwickeln wir unsere ganz persönliche Art von Lernen, die mehr oder weniger effektiv und/oder effizient ist. Eine Lehrperson, die sich dessen bewusst ist, wird den Lernstoff so aufbereiten, dass das Lernen verbessert und neue Lernerfahrungen gemacht werden können.

Überblick zu Kapitel 3: Was hat das Lernen mit der Biografie zu tun?
Gedächtnis: Etwas Neuropsychologie
Lernen ist erst dann effektiv und nachhaltig, wenn wir in der Lage sind, Unwichtiges von Wichtigem zu unterscheiden und Letzteres jederzeit abruf bar zu speichern.
Drei verschiedene Speicher
1. Das Ultrakurzzeitgedächtnis
Eindrücke, die über unsere Sinnesorgane ins Bewusstsein gelangen, bleiben für etwa zehn bis zwanzig Sekunden haften und werden danach wieder «gelöscht», wenn sie nicht «merkwürdig» genug sind (durch Irritation, aber auch dadurch, dass der Information von der Lehrperson Wichtigkeit zugeschrieben wird), dass wir ihnen keine Aufmerksamkeit schenken (bewusstes Wahrnehmen) oder dass sie nicht mit bereits bekannten Gedankenverbindungen verknüpft werden (Assoziation). Nach dieser Zeit kann der Sinneseindruck nicht mehr oder nur noch mit Mühe abgerufen werden. Klassische Beispiele solcher Informationen: die rote Ampel, das Abschalten der Herdplatte, das Überhören der Kirchenglocken, das Abschliessen der Haustüre usw.
2. Das Kurzzeitgedächtnis
Informationen, die «merkwürdig» sind oder eine Resonanz mit bereits gespeicherten Gedächtnisinhalten erzeugen, gehen vom Ultrakurzzeitgedächtnis ins Kurzzeitgedächtnis über. Das Kurzzeitgedächtnis speichert Informationen für etwa zwanzig Minuten, danach werden sie von neuen Informationen «überschrieben».
3. Das Langzeitgedächtnis
Wenn Informationen auch im Kurzzeitgedächtnis genügend Aufmerksamkeit erhalten, besteht eine gute Chance, dass sie ins Langzeitgedächtnis wandern. Dies kann auf unterschiedliche Arten erreicht werden: durch wiederholtes Ansprechen, Umsetzen in sinnvolle Aufgaben, durch repetiertes Lernen, vor allem aber dadurch, dass Prinzip, Zusammenhänge, Sinn und Nutzen verstanden werden. Inhalte, die im Langzeitgedächtnis verankert sind, sind prinzipiell immer wieder abruf bar.
Nachhaltiges Lernen
Da das Langzeitgedächtnis eine Unmenge von Informationen verwalten muss, werden diese nach Prioritäten geordnet. Informationen, die oft abgerufen werden (z. B. durch Repetition oder, noch besser, durch konkretes Anwenden und Üben), haben eine höhere Priorität als andere, stehen also schneller zur Verfügung.
Eingangskanäle: Hören und sehen, lesen und handeln
Jeder Mensch hat, je nach seinen bisherigen Lernerfahrungen, mehr oder weniger Übung mit den unterschiedlichen Eingangskanälen (Lerntypen).
Die unterschiedlichen Eingangskanäle (Lerntypen)
Hören (auditive Lerntypen)
Hören von Sprache: einfach, fast immer verfügbar
| → Vorteil |
geringer Aufwand |
| → Nachteil |
unanschaulich, verflüchtigt sich schnell |
Regeln für auditiv Lernende
•Wichtiges nachsprechen
•Wichtiges mitschreiben
•Sich Geschildertes im Kontext vorstellen
•Abstraktes in Geschichten verpacken
•Schwerpunkte mit Musik verbinden
Sehen (visuelle Lerntypen)
Symbole, Bilder, Farben
| → Vorteil |
unmittelbare Anschaulichkeit |
| → Nachteil |
aufwendiger, braucht Platz und Herstellungszeit |
Regeln für visuell Lernende
•Abbildungen beschriften
•Lesereihenfolgen festlegen
•Selbst nachzeichnen
•Aussehen und Bewegungen vorstellen
•Nach vorgebenen Gestaltungsregeln aufzeichnen
Lesen
| → Vorteil |
relativ geringer Aufwand |
| → Nachteil |
unanschaulich |
Regeln für lesend Lernende
•Wichtiges laut lesen
Читать дальше