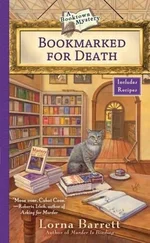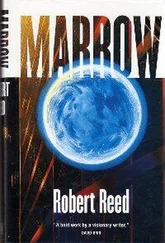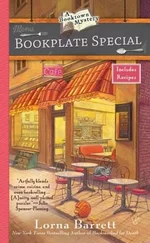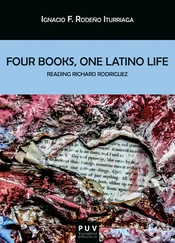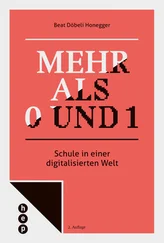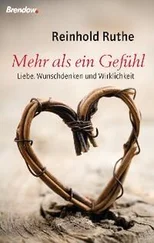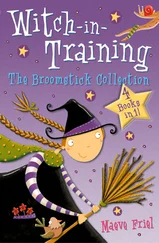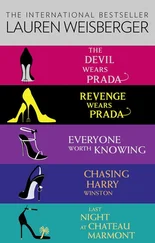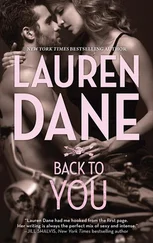2.Abwechslung von darbieten/erarbeiten lassen
Die Informationsaufnahmephasen wechseln mit aktiven Verarbeitungsphasen ab. Eine Informationsaufnahmephase dauert nicht länger als fünfzehn Minuten. Die aktiven Verarbeitungsphasen werden im Kursverlauf immer länger. Der Ablauf einer Unterrichtseinheit besteht somit aus einer Anfangssituation (Problemkonfrontation), einer Experimentier- oder Ausprobierphase, abwechselnden Informationsaufnahmephasen und aktiven Verarbeitungsphasen (Umsetzung) und einer Schlusssituation (Rekapitulation, Zusammenfassung).

3.Problemfindung/Problemformulierung
Fallbeispiele werden zugeschnitten auf Problemstellungen aus der Lebens- und Arbeitswelt der Lernenden gestaltet, benötigte Techniken und Theoriemodelle werden in zunehmendem Schwierigkeitsgrad eingebaut.

4.Problemlösen lehren
Statt die Lehrperson nach der Lösung eines Problems zu fragen, suchen die Lernenden immer wieder selbst Lösungswege, damit sie sich im Verlaufe des Kurses von der Lehrperson unabhängig machen können. Die Lehrperson weist auf Informationsquellen hin, die zur Lösung beitragen.

5.Bei den Lernenden ansetzen
Die Lernenden bringen ihre Alltagserfahrung und ihre Berufswelt in den Kurs mit, diese Bilder/Analogien der Lernenden werden im Unterricht so oft wie möglich verwendet. Die Lehrperson macht es sich zur Aufgabe, so schnell wie möglich herauszufinden, in welcher Vorstellungswelt die Lernenden leben. Sie fragt nach vorhandenem Wissen und vorhandenen Ideen, hält diese fest und knüpft daran an.

6.Fragehaltung aktiv aufbauen
Die Lernenden bringen ihre Fragen mit, können sie aber meistens nicht spontan formulieren oder getrauen sich nicht. Die Lehrperson fördert Fragen und sammelt sie in einem Fragenspeicher. Theorie wird so wenig wie möglich im Voraus vermittelt, um die Fragen der Lernenden nicht abzuwürgen. Fragen werden beantwortet, wenn sie beim Umsetzen auftauchen; Fallbeispiele werden so konstruiert, dass die Lernenden automatisch auf gewisse Fragen stossen.

7.Fehlermanagement
Fehler sind gut! Aus Fehlern kann ich lernen. Nur wer nichts macht, macht keine Fehler. Diese Einstellung gegenüber Fehlern (auch denjenigen der Lehrperson!) muss im Kursalltag vorherrschen und durch die Lehrperson vorgelebt werden.

8.Lernkontrolle
Die Lernkontrollen gehen von praxisnahen Problemstellungen aus. Sie können anhand einer Musterlösung durch die Lernenden selbst kontrolliert werden und sind ziemlich komplex. Sie sind ähnlich schwierig und gleich aufgebaut wie die Prüfungsfragen.

Fazit
Lehren in der Erwachsenenbildung verlangt von den Lehrpersonen mehr und anderes als Wissensvermittlung. Der erhöhte Stoff-, Zeit- und Prüfungsdruck macht es unumgänglich, dass sich auch ausgewiesene Fachspezialisten mit methodisch-didaktischen Themen beschäftigen.
Die neuen, unverzichtbaren Anforderungen an die Lehrpersonen beinhalten:
•Beschäftigung mit der Korrelation von Lehren und Lernen,
•Vorbereitung und Gestaltung der Lernumgebung,
•Aufbereitung und methodisch abwechslungsreiche Darbietung des Stoffs,
•Planung und Einsatz visueller Medien,
•Bereitstellen von Lehr- und Lernmaterialien,
•Steuerung der Zusammenarbeit in Gruppen,
•Kontrolle der Lernfortschritte,
•Überwachung der Unterrichtsqualität.
Deshalb genügen Präsentationen und Referate oder Vormachen/Nachmachen über zusammengeschaltete Bildschirme dem heutigen Anspruch an professionelle berufliche Weiterbildung nicht. Der Selbsttest in diesem Kapitel gibt der Lehrperson Anhaltspunkte, wo Verbesserungsmöglichkeiten liegen.
Weiterführende Literatur
Arnold R.: Wie man lehrt, ohne zu belehren.
Dollinger M.: Wissen wirksam weitergeben.

Kapitel 2
Wenn Erwachsene lernen
«Der Kluge lernt aus allem und jedem, der Normale aus seinen Erfahrungen, und der Dumme weiss schon alles besser.»
Sokrates
Worum es in diesem Kapitel geht
In diesem Kapitel geht es um das Lernen Erwachsener in der Weiterbildung. In welchem Bildungssystem sich Erwachsenenbildung abspielt und wie Erwachsene lernen, welche Bedürfnisse und Erwartungen sie haben – all dies hat einen Einfluss auf die Art und Weise, wie eine Lehrperson im Kursraum die Beziehungsebene gestalten kann.

Überblick zu Kapitel 2: Wenn Erwachsene lernen
Die Weiterbildungslandschaft Schweiz
Das schweizerische Bildungssystem mit seiner intensiven Verzahnung zwischen der betrieblichen Praxis und der schulischen Bildung ist einzigartig. Was sich als duales Berufsbildungssystem bewährt hat, ist in der beruflichen und persönlichen Weiterbildung nicht einfach weiterzuführen. Hochschulen, Fachhochschulen, höhere Fachschulen und Privatschulen bzw. innerbetriebliche Bildungsabteilungen verstricken sich seit ein paar Jahren verstärkt in Konkurrenzkämpfe. Dieses Positionierungsgerangel ist unter anderem auf die Bestrebungen nach internationaler Vereinheitlichung (Bologna-Reform, Kopenhagen-Prozess) und die Verknappung der finanziellen Mittel zurückzuführen. Beide Entwicklungen werden weiterhin wirksam sein. Dazu kommen noch weitere Trends, die die Positionierung stark beeinflussen.
Trends
Neuer Bildungsbegriff
Bildung verschiebt sich zunehmend von der Schule in die Praxis hinüber, also muss Bildung in einer dynamischen Wissensgesellschaft zunehmend berufliche Kompetenz vermitteln. Das neue Bildungsideal heisst Employability, also Einsetzbarkeit, Verwertbarkeit (statt klassisches Bildungsideal).
Arbeitsprozess als Weiterbildungsprozess
Arbeiten und Lernen sowie Beruf und Freizeit überlappen sich. Deshalb gelten Persönlichkeitsbildung, Metakommunikation und emotionale Intelligenz als neue Basisqualifikationen. Vermehrt werden Skills und Fähigkeiten am Arbeitsplatz gelernt (training on the job). Berufliche Weiterbildung gewinnt an Bedeutung – sie soll aber effizient sein und sich wirtschaftlich auszahlen.
Читать дальше