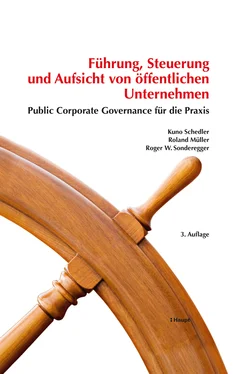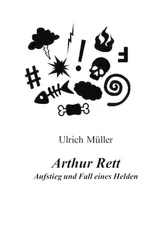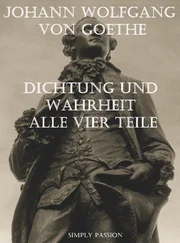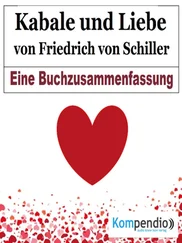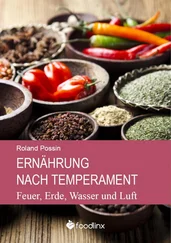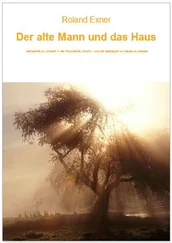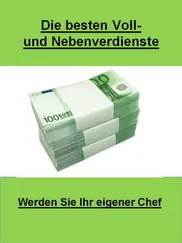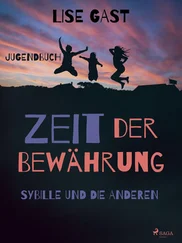1.5.4 Führung in der Krise
Gerät ein öffentliches Unternehmen in eine Krisensituation, kann es aus politischen Gründen (z.B. um die Akzeptanz der getroffenen Lösungen
zu erhöhen) angezeigt sein, kurzfristig einen politischen Durchgriff auf die Unternehmensführung vorzunehmen.
1.5.5 Konkret ausformulierte Muster
Im vorliegenden Buch sind alle Grundlagen betreffend Public Corporate Governance auf wissenschaftlicher und praktischer Ebene erarbeitet und dargestellt. Zudem sind in allen Abschnitten Checklisten und Empfehlungen für die Umsetzung in der Praxis eingefügt. Konkret ausformulierte Muster z.B. einer Eignerstrategie sind in Kapitel 11 publiziert. Wichtig ist aber der Hinweis, dass diese nicht ohne kritische Prüfung und nicht ohne individuelle Anpassungen übernommen werden können.
1.6 Zur Bedeutung von informellen Strukturen
In diesem Handbuch werden eine Reihe von Hinweisen vorgestellt, die sich auf die formale Gestaltung der Corporate Governance einer öffentlichen Unternehmung beziehen. Die Autoren sind sich dabei bewusst, dass die tatsächliche Steuerung einer öffentlichen Unternehmung in der Praxis oft von informellen Absprachen beeinflusst ist. Politische Entscheidungen werden vorab in Arbeitsgruppen vorbereitet, die einen entsprechenden Auftrag haben können – oder auch nicht. Das Ausmass der Formalisierung von Steuerung hängt nicht zuletzt auch von der «Chemie» ab, die zwischen den Verantwortlichen aus Politik, Verwaltung und öffentlicher Unternehmung – und deren jeweiligen engeren Mitarbeitenden – herrscht.
Zur Verdeutlichung ein Beispiel: Auf Bundesebene war über viele Jahre eine Gruppe von Personen in den verantwortlichen Funktionen tätig, die sich gegenseitig kannten und schätzten, was die informelle Absprache deutlich erleichterte. Das zuständige Exekutivmitglied, der Departementssekretär, der Leiter einer Verwaltungseinheit und CEOs von Bundesunternehmen gehörten dieser Gruppe an. Die Formalisierung von Zielvorgaben wurde zwar in dieser Zeit vorangetrieben, aber das Ganze war gemäss Aussagen der Betroffenen getragen von einer kollegialen Atmosphäre.
Wo solche informellen Kontakte nicht im gleichen Ausmass vorhanden sind, haben die formellen Steuerungsinstrumente einen grösseren Stellenwert. Fehlendes Vertrauen muss hier zuerst aufgebaut werden. Dazu kann die Transparenz, die durch die Instrumente geschaffen wird, einen wesentlichen Beitrag leisten.
Im öffentlichen Raum (d.h., wo Aufgaben im öffentlichen Interesse wahrgenommen werden) haben formelle Steuerungsinstrumente eine zusätzliche Funktion: Sie sind in der Lage, demokratische Legitimation herzustellen. Die Schriftlichkeit und Zugänglichkeit, und damit verbunden die Nachvollziehbarkeit durch Aufsichtsgremien, ist beispielsweise eine wesentliche Voraussetzung für die parlamentarische Kontrolle im Rahmen der Oberaufsichtsfunktion. So effizient und effektiv die informellen Absprachen zwischen CEO, Verwaltung und Politikern sein mögen, so sehr bedarf es im öffentlichen Raum transparenter Verfahren, welche die Rechtmässigkeit und die demokratische Legitimität der Steuerung öffentlicher Unternehmen sicherstellen.
1.7 Die Bedeutung des Politischen in der Public Corporate Governance
Öffentliche Unternehmen unterscheiden sich in zwei wichtigen Elementen von privatwirtschaftlichen Unternehmen:
1 Sie erbringen in der Regel Leistungen für die Öffentlichkeit, was in der Schweiz als Service Public bezeichnet wird. Daraus entsteht eine besondere Verantwortung, denn unter Umständen können weite Teile der Gesellschaft von der Leistungserbringung betroffen sein. Besteht keine Alternative zu diesen Leistungen, z.B. über den Markt, so ist die Abhängigkeit umso grösser.
2 Sie sind durch das Eigentum der öffentlichen Hand Teil des Staates und unterliegen der demokratischen Kontrolle.
Beide Elemente führen dazu, dass die Politik ein legitimes Interesse daran hat, auf die öffentlichen Unternehmen einzuwirken. Die Leistungspalette des öffentlichen Unternehmens wird in aller Regel über eine Leistungsvereinbarung festgelegt. Darin ist festgehalten, welche Leistungen vom öffentlichen Unternehmen in welcher Form erwartet werden. Die Regeln, die dem öffentlichen Unternehmen als Teil des Staates auferlegt werden, sind in Spezialgesetzen und in allgemeinen Bestimmungen festgelegt. Deren Einhaltung wird von staatlichen Organen überprüft, beispielsweise von der Finanzkontrolle des Bundes oder eines Kantons. Über allem steht immer der Anspruch, dass öffentliche Unternehmen öffentliche Leistungen zu erbringen haben und gegenüber der Öffentlichkeit Red und Antwort stehen müssen.
Im Grundsatz besteht dazu bestimmt Einigkeit. Die Schlüsselfrage ist nun aber, wie die Steuerung und Überwachung der öffentlichen Unternehmen durch die Politik (als Vertretung der Bürgerinnen und Bürger) organisiert sein und wie sie erfolgen soll. Der Umstand, dass öffentliche Unternehmen ausgegliedert sind, macht deutlich, dass die Politik ihnen mehr Autonomie geben wollte als der allgemeinen Verwaltung. Dennoch muss sie ihre Aufsichts- und Steuerungsfunktion wahrnehmen können.
Aus der Sicht der Autoren lassen sich einige Grundsätze der politischen Steuerung öffentlicher Unternehmen festhalten, aus denen operative Lösungen abgeleitet werden können:
1 Gewährleistungs-Optik: Im Vordergrund steht immer der Auftrag der Politik, eine optimale Versorgung der Gesellschaft mit öffentlichen Leistungen sicherzustellen.
2 Strategische Angaben: Ist eine öffentliche Unternehmung in die grössere Selbständigkeit entlassen, so kann und soll sie nicht mehr über detaillierte Eingriffe in die operative Tätigkeit geführt werden. Vielmehr ist die Politik gefordert, der öffentlichen Unternehmung klare strategische Vorgaben zu machen: Wie soll sie sich positionieren? Was soll ihre Rolle im Staat sein? Auf welche Entwicklungen soll sie sich vorbereiten? Diese Vorgaben werden in der Folge als Eignerziele bezeichnet.
3 Management by Exception: Auch wenn sich die Politik im Regelfall auf die strategischen Vorgaben beschränken soll, so bleibt sie oft auch für operative Entwicklungen politisch verantwortlich. Daher kann es im Einzelfall notwendig sein, dass politische Überlegungen in operative Entscheidungen einfliessen. Dies kann aber nur die Ausnahme sein – die Regel muss bleiben, dass die Strategische Führungsebene gemeinsam mit der Operativen Führungsebene die Geschicke der Unternehmung lenkt.
4 Transparenz: Eine Vergrösserung der Autonomie einer staatlichen Organisation will kompensiert sein. Vermeintliche Einflussmöglichkeiten der Politik, die sie zugunsten einer strategischen Führung aufgeben muss, vergrössern das Misstrauen gegenüber der öffentlichen Unternehmung. Dies kann oft nur durch grosse Transparenz kompensiert werden. Transparente Prozesse der personellen Besetzung der Strategischen und der Operativen Führungsebene, transparente Rechnungslegung, transparente Leistungs- und Wirkungsberichte sind die Grundlage für Vertrauen gegenüber dem öffentlichen Unternehmen.
5 Vermeidung von Interessenkonflikten: Erfolgt eine politische Einflussnahme auf das öffentliche Unternehmen, so besteht eine Gefahr von Interessenkonflikten. Insbesondere in der kleinen Schweiz ist es nicht immer einfach, genügend gute Leute für politische Ämter und Vorstandsfunktionen zu finden. Die Versuchung einer Ämterkumulation ist daher latent vorhanden. Wer aber zu viele Ämter an sich zieht, läuft Gefahr, dass zwischen den verschiedenen Rollen Interessenkonflikte auftreten, die kaum überwindbar sind.
6 Einsitznahme von Exekutivmitgliedern: Grundsätzlich sollten Mitglieder der Exekutive nicht direkt Einsitz in die Strategische Führungsebene eines öffentlichen Unternehmens nehmen. So sollten z.B. Regierungsräte eines Kantons nicht Mitglieder des Verwaltungsrates des kantonalen Elektrizitätsversorgungsunternehmens sein. Dabei ist die betroffene Person einem dauernden Interessenkonflikt ausgesetzt. Im angeführten Beispiel müsste der Regierungsrat als Vertreter des Kantons auf möglichst tiefen Energiepreisen bestehen, als Mitglied der Strategischen Führungsebene müsste er zur Verbesserung der Rentabilität aber möglichst hohe Energiepreise ansetzen. Vor diesem Hintergrund wird die Thematik vertieft und die Vor- und Nachteile einer Einsitznahme dargelegt. Die Entscheidung hat letztlich jedes einzelne Mitglied der Exekutive selbst zu treffen, falls nicht eine übergeordnete Regelung den Umgang im Grundsatz definiert (6.4 Einsitznahme der Exekutive in der Strategischen Führungsebene, 118).
Читать дальше