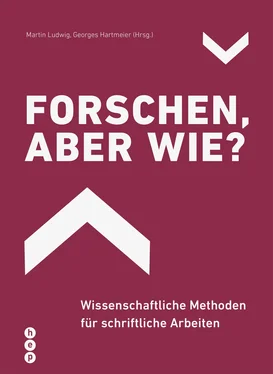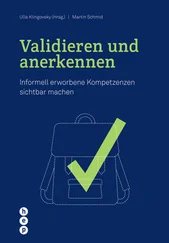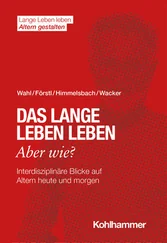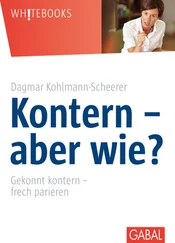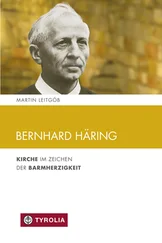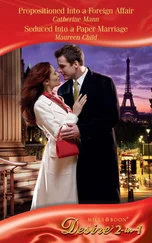In wissenschaftlichen Publikationen liest man anstatt «ich, mein, mir» folgende oder ähnliche Wendungen: «Die Analyse ergibt»; «Das Ergebnis unterstreicht»; «Man kann vermuten»; «Es lässt sich zeigen» und Passivkonstruktionen wie «Es wurde weiter oben dargelegt» (vgl. ebd., S. 143). Damit stellen die Schreibenden die Sache ins Zentrum und nicht sich selbst. Sie vermeiden es, ins Persönliche abzugleiten. Entscheidend ist aber nicht, ob Sie in Ihrem Text das Pronomen «Ich» verwenden, sondern wie Sie es verwenden. Sie dürfen die Leserin oder den Leser im eigenen Namen auf etwas hinweisen wie «Im nächsten Kapitel werde ich auf diese Ergebnisse eingehen» oder eine methodische Anmerkung machen wie «Daher wählte ich dieses Vorgehen». Es darf im Text aber nie um Ihre persönlichen Erfahrungen und Gefühle gehen, beispielsweise «Nach langem Kopfzerbrechen und einigen Gesprächen mit meiner Betreuerin fühlte ich mich mit dieser Methode am wohlsten».
Wenn Sie wissenschaftlich schreiben, nehmen Sie auch Bezug auf andere Texte. Sie bemühen sich, die gewählte Quelle möglichst genau zu verstehen, Sie geben deren Aussage korrekt wieder, und Sie legen ihre Bedeutung für die eigene Arbeit dar. Wie Sie Fachliteratur und andere Quellen ausweisen und korrekt in Ihren Text einbauen, erfahren Sie in Abschnitt 2.3.
1.4.3 Wissenschaftliche Standards erfüllen
Nun haben Sie gelernt, was wissenschaftliches Argumentieren heisst, Sie haben die Grundzüge von Forschung als Wahrheitssuche und Falsifizierbarkeit als Abgrenzungskriterium für wissenschaftliche Theorien kennengelernt, und Sie haben Tipps erhalten, wie Sie Ihre Gedanken in einer angemessenen Sprache ausdrücken.
Eines bleibt noch zu klären: An der Kick-off-Veranstaltung für Maturaarbeiten wurde höchstwahrscheinlich erwähnt, dass Sie eine eng gefasste Fragestellung einreichen sollen, denn je stärker Sie Ihre Untersuchung fokussieren, desto eher sei es möglich, nach wissenschaftlichen Prinzipien vorzugehen und dabei etwas Neues herauszufinden oder etwas Ungewöhnliches zu konstruieren.
Die Maturaarbeit ist eine Übung auf ansprechendem Niveau, die auf das wissenschaftliche Arbeiten vorbereitet. Es ist dabei erwünscht, dass Sie sich innerhalb der Leitlinien der Wissenschaftlichkeit bewegen. Die folgenden Ausführungen zeigen, dass dies durchaus machbar ist.
Objektivität: Die forschende Person nimmt eine kritische, analysierende Position zum Forschungsgegenstand ein. Sie macht durch sprachliche Mittel klar, welches ihre eigenen Forschungsresultate sind, welche Aussagen sie von anderen Forschenden referiert und welche Schlüsse sie daraus zieht. Subjektive und persönliche Urteile sollen klar als solche erkennbar sein (vgl. Voss 2017, S. 33). Übertragen auf meine Maturaarbeit: Ich stehe meinem Untersuchungsgegenstand kritisch gegenüber ( SMART-Analyse, hier), mache, wenn ich fremde Gedanken übernehme, konsequent einen Quellenverweis und trenne klar zwischen den erarbeiteten Fakten und meiner Meinung.
Intersubjektivität: Forschungsresultate sind für die anderen Forschenden erfassbar, sie sind wiederholbar, und die Schlussfolgerungen, die aus dem Sachverhalt abgeleitet werden, sind nachvollziehbar (vgl. Sandberg 2017, S. 15). Die von mir erhobenen Daten, Berechnungen, Argumentationsketten oder technischen Konstruktionen sind für die Leserinnen und Leser verständlich. Ich führe ein Arbeitsjournal und gegebenenfalls ein Versuchs- oder Beobachtungsprotokoll und dokumentiere alle Vorfälle sorgfältig, auch die Misserfolge.
Methodisch begründetes Vorgehen: Die Methode, mit der die Erkenntnisse gewonnen wurden, ist detailliert beschrieben. Es soll klar werden, warum die Methode gewählt und wie sie angewendet wurde (vgl. Kruse 2010, S. 58). Ich erläutere die von mir angewendeten Methoden detailliert und begründe, warum ich welches Verfahren gewählt habe.
Systematik: Jede Wissenschaftsdisziplin hat ihre eigene Systematik. Die eigene Forschung muss an die Wissenssystematik des Fachs angebunden und im Kontext des vorhandenen Wissens dargestellt und eingeordnet werden (vgl. ebd.). Nach einer ausgedehnten Literaturrecherche lese ich mich ins Thema ein. Die Fachwörter, die ich bei der Lektüre antreffe, verwende ich auch in meiner Arbeit, allerdings nicht, ohne sie zu erklären und gegebenenfalls zu definieren.
Die Forderung nach einer klaren Grundhaltung, welche die Forschenden einnehmen sollten, fasste der amerikanische Soziologe Robert K. Merton in einem Fünf-Punkte-Kriterienkatalog für Wissenschaftsethik zusammen. Diese Forderungen seien an den Schluss des Kapitels gestellt – im Wissen, dass sie im heutigen Forschungsbetrieb häufig nicht eingehalten werden.
Merton stellte in den Dreissigerjahren mit einiger Beunruhigung fest, dass viele deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bereit waren, sich in den Dienst des nationalsozialistischen Regimes zu stellen. Deshalb entwickelte er grundlegende Normen wissenschaftlicher Forschung, die – nach ihren Anfangsbuchstaben benannt – als CUDOS-Kriterien berühmt wurden und die Diskussion in der Wissenschaftsethik bis heute prägen (vgl. Sandberg 2017, S. 16).
Communitarism(hier etwa mit Gemeinschaftssinn zu übersetzen): Alle wissenschaftlichen Erkenntnisse gehören allen. Sie sollen mit der Gemeinschaft der Forschenden und der Öffentlichkeit geteilt werden.
Universalism(Universalität): Forschungsergebnisse müssen unabhängig von der Person, ihrem Geschlecht, ihrer Volkszugehörigkeit, ihrer Nationalität oder ihrer Religion geprüft und bewertet werden.
Desinterestedness(Uneigennützigkeit): Antriebsfeder für das Forschen soll nicht eigennütziges Interesse sein, sondern die Leidenschaft für die Wahrheitssuche.
Originality(Originalität): Wissenschaft soll einen Erkenntnisgewinn bringen, indem etwa ein neuer methodischer Zugang erarbeitet oder eine neue Theorie entwickelt wird.
Scepticism(Skeptizismus): Alle Erkenntnisse und ihre dazugehörigen Beweise sind einer kritischen Prüfung zu unterziehen, bevor sie anerkannt werden.
Eine weitere unabdingbare Vorbereitung auf Ihre erste wissenschaftliche Arbeit ist die Informationsrecherche. Wir empfehlen Ihnen dringend, Kapitel 2zu lesen, bevor Sie sich in die Arbeit stürzen.
Alagöz-Bakan, Özlem; Knorr, Dagmar; Krüsemann, Kerstin (Hrsg.): Akademisches Schreiben, Sprache zum Schreiben – zum Denken – zum Beraten. Universitätskolleg-Schriften, Bd. 14. Hamburg: Universität Hamburg 2015.
Amnesty International, Greenpeace, Helvetas (Hrsg.): Learning for the Planet. Online: http://learning-for-the-planet.org/[Abrufdatum: 14.08.2018].
Amt für Landschaft und Natur: Rotwildkonzept Kanton Zürich (2017). Online: https://aln.zh.ch/internet/baudirektion/aln/de/aktuell/mitteilungen/2017/rotwildkonzept-kanton-zuerich/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/746_1513760484284.spooler.download.1513752504493.pdf/ALN_Fischerei%26Jagd_Rotwildkonzept_def.pdf[Abrufdatum: 14.08.2018].
Baez, Joan: Ihre persönliche Webseite: www.joan.baez.com. Dort weiter zu «Discography», dann «Joan Baez Lyrics», oder direkt: www.joanbaez.com/discography/[Abrufdatum: 14.08.2018]. Bemerkung: Der Link reagiert sehr langsam, und der ganze Text der Songs wird erst durch das Hinunterschieben eines gelben Scrollbalkens sichtbar, der erscheint, wenn der Text angeklickt wird.
Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft; Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft; Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft; Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (Hrsg.): waldwissen.net. Information für die Forstpraxis. Online: www.waldwissen.net[Abrufdatum: 22.08.2018].
Читать дальше