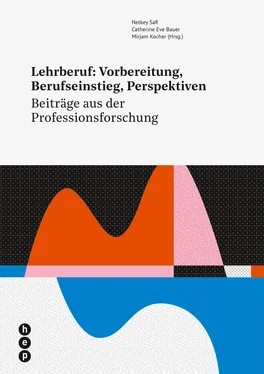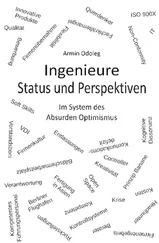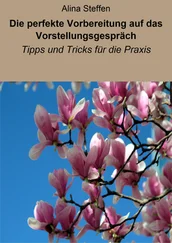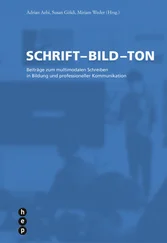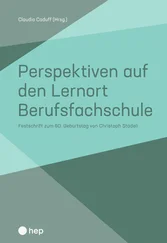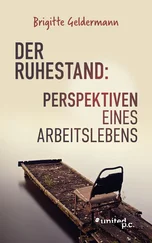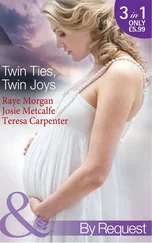4.2Berufsziele: Berufswechselnde zielen stärker auf Schulleitung oder Bildungsadministration
Die meisten der befragten Studierenden geben an, als Lehrpersonen der Volksschule arbeiten zu wollen; weitere Funktionen im Bildungssystem oder eine Tätigkeit in Forschung und Entwicklung sind deutlich seltenere Ziele. Dieser Befund stimmt überein mit generellen Studienresultaten bei Lehramtsstudierenden (PaLea; Kauper et al., 2012). Zwischen BW und EB zeigen sich allerdings kleine Unterschiede: BW nennen häufiger als EB als Ziel, eine weitere Funktion im Bildungssystem zu übernehmen, während EB häufiger Lehrpersonen bleiben wollen. Der Befund entspricht den Erwartungen insofern, als BW ein besonders großes Bildungsinteresse und hohe Selbstwirksamkeitserwartungen aufweisen (Weinmann-Lutz et al., 2006), die sie eher zu einem erneuten Wechsel der Berufstätigkeit prädestinieren. Zudem ist plausibel, dass BW sich stärker mit den beruflichen Perspektiven des neuen Berufs auseinandergesetzt haben als EB, da ein Berufswechsel mit einem hohen Ressourceneinsatz verbunden ist. Letzterer macht in Verbindung mit den beruflichen Perspektiven einen wichtigen Anteil der Kosten-Nutzen-Abwägungen aus (Denzler & Wolter, 2008). Es ist plausibel, dass BW ihre Ressourcen für potenzielle berufliche Weiterentwicklungen in diese Überlegungen einfließen lassen. BW in den Lehrberuf haben an der PHBern häufig einen kaufmännischen Hintergrund (Troesch & Bauer, 2017) und bringen gemäß Selbsteinschätzung vielfältige administrative, organisatorische und kommunikative Kompetenzen mit (Bauer, Aksoy, Troesch & Hostettler, 2017). Diese sind in weiterführenden Funktionen des Bildungssystems hilfreich, zum Beispiel in der Schulleitung oder Bildungsadministration.
4.3Früherer beruflicher Status: Kein Einfluss auf Berufsziele und Berufswahlmotive
Die Analysen zeigen für die BW keinerlei Einfluss des früheren beruflichen Status auf die Berufswahlmotive oder die Berufsziele. Die bisherige Datenlage zu diesem Thema ist widersprüchlich: Dass ein Berufswechsel nicht völlig unabhängig vom beruflichen Status des Vorberufs geschieht, zeigen diverse Interviewstudien sehr klar. Der Wunsch nach sozialer Anerkennung und gesellschaftlichem Aufstieg kann ein wesentlicher Grund sein für die Entscheidung, sich zur Lehrperson umschulen zu lassen (Loretz et al., 2017; Kappler, 2016; Weinmann-Lutz et al., 2006). Gleichzeitig können nicht alle Studien diese Einflüsse bestätigen (z. B. Wilkins & Comber, 2015). Hinsichtlich der Berufsziele fehlen systematische Untersuchungen, allerdings fanden Watt und Richardson (2008) einen positiven Zusammenhang zwischen dem Statusgewinn beim Berufswechsel und der Absicht, im Lehrberuf zu verbleiben.
Unsere Daten scheinen Studien zu widersprechen, die einen Einfluss des früheren beruflichen Status auf den Berufswechsel nahelegen. Unsere Vermutung ist allerdings, dass es sich bei diesen Widersprüchen um ein methodisches Artefakt handeln könnte: Die Stichproben der verschiedenen Studien variieren stark mit Blick auf den Status des früheren Berufs: An der PHBern schreiben sich traditionellerweise viele Studierende mit früheren Abschlüssen im Kaufmännischen und im Gesundheitsbereich ein. Diese Abschlüsse sind im sozialen Status gemäß ISEI sowohl einander als auch dem Lehrberuf ähnlich. Die Statusänderungen bei einem Wechsel in den Lehrberuf sind für diese Stichprobe folglich eher klein. Sind Statusänderung und Berufswahlmotivation beziehungsweise Berufsziele miteinander assoziiert, ist zu erwarten, dass der Effekt mit zunehmendem Statusgewinn oder -verlust größer wird.
In der vorliegenden Untersuchung waren BW im Verhältnis zur Gesamtstichprobe überrepräsentiert (PHBern, 2018). Dies könnte zu Verzerrungen in den Resultaten geführt haben. Die Studienteilnahme war zudem freiwillig und anonym. So kann nicht ausgeschlossen werden, dass besonders motivierte Studierende teilgenommen haben. Des Weiteren wurden die vorliegenden Daten querschnittlich erhoben, daher lassen sich die gefundenen Unterschiede nicht kausal zuordnen. Beispielsweise wurde das Alter in allen Analysen statistisch kontrolliert; allerdings kann nicht ausgesagt werden, ob die bedeutsamen Effekte tatsächlich auf den Berufswechsel zurückzuführen sind oder auf andere Aspekte wie beispielsweise die durch das Alter bedingte größere Lebenserfahrung.
Bezüglich der Berufswahlmotive sind BW keine grundsätzlich andere Zielgruppe als Studierende, die direkt nach dem Gymnasium in die Lehrerinnen- und Lehrerbildung eintreten: BW sind ebenso motiviert für den Lehrberuf wie andere Studierende auch, und der Lehrberuf ist für sie ebenso selten eine Verlegenheitslösung. Dies ist für die Bildungspolitik und Schulpraxis ein positiver Bescheid. Die zunehmende Öffnung der pädagogischen Hochschulen für heterogene Zielgruppen ist also grundsätzlich positiv zu bewerten und trägt nicht dazu bei, dass mehr Personen in den Lehrberuf eintreten, die diesen aus vornehmlich extrinsischen Gründen wählen.
Gleichzeitig positionieren sich Personen, die erst auf dem zweiten oder dritten Karriereweg in die Lehrerinnen- und Lehrerbildung eintreten, hinsichtlich ihrer Berufsziele als spezielle Zielgruppe. BW zeichnen sich als angehende Lehrpersonen dadurch aus, dass sie stärker über den Beruf als Volksschullehrperson hinausdenken und sich eher etwa als Schulleitende oder Mitarbeitende in der Bildungsadministration sehen als andere Studierende. Unter dieser Prämisse muss das Thema Berufsausstieg neu evaluiert werden: Wenn mit der Zahl der BW auch die Zahl der Lehrpersonen zunimmt, die Interesse an einer beruflichen Weiterentwicklung im Rahmen des Bildungssystems haben, ist dies, bildungspolitisch gesehen, durchaus wünschenswert. In den Statistiken werden diese Personen dereinst allerdings unter dem negativ konnotierten Stichwort «vorzeitiger Berufsaustritt» geführt. Für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung heißt dies: Nach wie vor muss als Maxime gelten, qualifizierte Lehrkräfte auszubilden und im Beruf zu halten. Diese Maxime muss aber erweitert werden: In dem Maße, wie sich Berufsbilder und Erwerbsbiografien verändern und flexibilisieren, werden mehr und mehr Lehrpersonen ausgebildet werden, die den Lehrberuf nicht als Endstation einer Karriere sehen, sondern als Zwischenschritt. Dies ist nicht grundsätzlich negativ zu bewerten, sondern kann als Anregung verstanden werden, Karrieren und Perspektiven innerhalb des Bildungssystems neu zu denken.
Literatur
Bauer, C. E., Aksoy, D., Troesch, L. M., & Hostettler, U. (2017). Herausforderungen im Lehrberuf: Die Bedeutung vorberuflicher Erfahrungen. In C. Bauer, C. Bieri-Buschor & N. Safi (Hrsg.), Berufswechsel in den Lehrberuf. Neue Wege der Professionalisierung (S. 119–138). Bern: hep.
Bauer, C. E., & Troesch, L. M. (2016). Berufsleute als Lehrpersonen II: Professionelle Entwicklung im Studium. Bern: PHBern.
Brühwiler, C. (2001). Die Bedeutung von Motivation in der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung. In F. Oser & J. Oelkers (Hrsg.), Die Wirksamkeit der Lehrerbildungssysteme: Von der Allrounderbildung zur Ausbildung professioneller Standards (S. 243–397). Chur: Rüegger.
Bruinsma, M., & Jansen, E. P. W. A. (2010). Is the motivation to become a teacher related to pre-service teachers’ intentions to remain in the profession? European Journal of Teacher Education, 33 (2), 185–200. doi: 10.1080/02619760903512927.
Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis für the behavioral sciences. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
Denzler, S., & Wolter, S. C. (2008). Selbstselektion bei der Wahl eines Lehramtsstudiums: Zum Zusammenspiel individueller und institutioneller Faktoren. Beiträge zur Hochschulforschung, 4 (30), 112–141.
Читать дальше