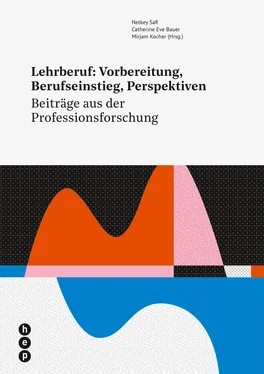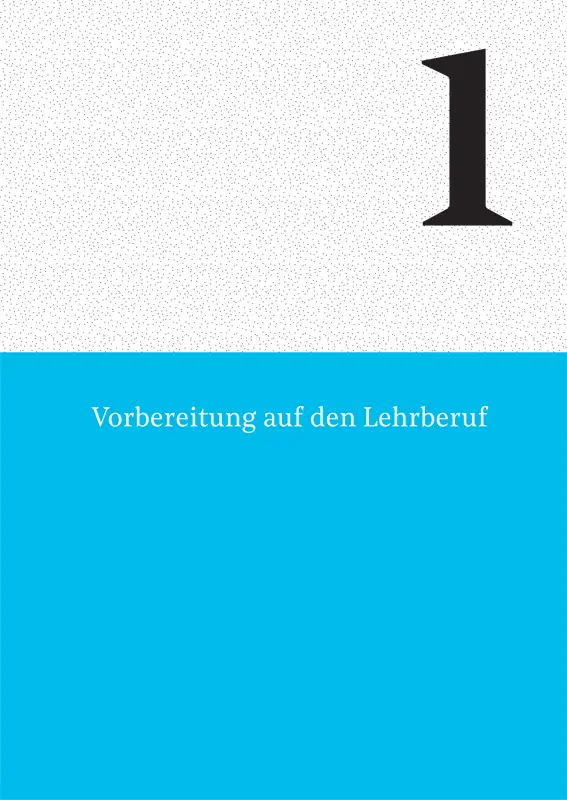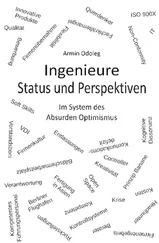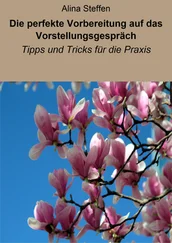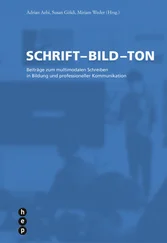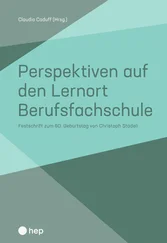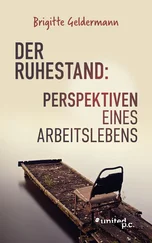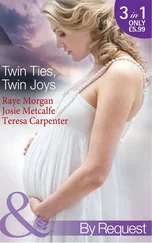Der Sammelband schließt mit einem kurzen Ausblick der Herausgeberinnen auf zukünftige Fragestellungen im Forschungsfeld.
Unser Dank gilt allen Autorinnen und Autoren, die mit ihren Beiträgen zur Entstehung dieses Bandes beigetragen haben, sowie den drei pädagogischen Hochschulen FHNW, Bern und Zürich, die sowohl die Arbeit am Sammelband selbst als auch die zugrunde liegende Tagung finanziell unterstützt haben.
Brugg-Windisch, im Juni 2019
Netkey Safi, Catherine Eve Bauer und Mirjam Kocher
Literatur
Bauer, C. E., Bieri Buschor, C., & Safi, N. (Hrsg.) (2017). Berufswechsel in den Lehrberuf. Neue Wege der Professionalisierung. Bern: hep.
Criblez, L. (2017). Lehrerinnen- und Lehrermangel in den 1960er- und frühen 1970er-Jahren – Phänomen, Maßnahmen, Wirkungen. In C. E. Bauer, B. C. Bieri Buschor & N. Safi (Hrsg.), Berufswechsel in den Lehrberuf. Neue Wege der Professionalisierung (S. 21–36). Bern: hep.
Helsper, W., & Tippelt, R. (2011). Ende der Profession und Professionalisierung ohne Ende? Zwischenbilanz einer unabgeschlossenen Diskussion. Zeitschrift für Pädagogik, Beiheft 57 , 268–288. Weinheim: Beltz.
Lortie, D. (2002). Schoolteacher: A sociological study . Chicago: University of Chicago Press.
Messner, H., & Reusser, K. (2000). Die berufliche Entwicklung von Lehrpersonen als lebenslanger Prozess. Beiträge zur Lehrerbildung, 18 (2), 157–169.
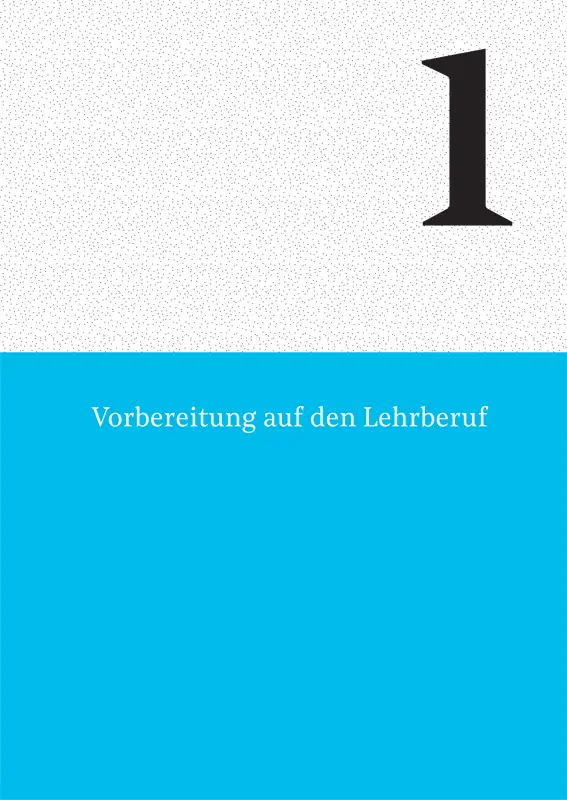
Motiviert für den Berufswechsel: Spielt der frühere berufliche Status eine Rolle?
Larissa Maria Troesch, Dilan Aksoy und Catherine Eve Bauer
Aus welchen Motiven angehende Lehrkräfte ihren Beruf wählen, gilt als zentraler Prädiktor für die Anstrengungen, die sie im Studium unternehmen, und den dadurch bedingten Kompetenzaufbau (Brühwiler, 2001; König & Rothland, 2012). Zusammenhänge der Berufswahlmotive bestehen auch mit der Absicht, in Studium und Beruf zu verbleiben (Bruinsma & Jansen, 2010; Sinclair, 2008); für die Rekrutierung und Ausbildung von Lehrkräften und die Förderung des Verbleibs im Beruf sind deshalb die Berufswahlmotive von hoher Relevanz. Die Frage, aus welchen Gründen angehende Lehrkräfte ihren Beruf ergreifen, ist denn auch breit erforscht (Rothland, 2014a, 2014b). Seit einigen Jahren richtet sich die Forschung zur Berufswahlmotivation nicht nur auf Lehramtsstudierende im Allgemeinen, sondern auch spezifisch auf Studierende, die auf einem zweiten Karriereweg das Lehramtsstudium ergriffen haben (Loretz, Schär, Keck Frei & Bieri Buschor, 2017; Neuber, Quesel, Rindlisbacher, Safi & Schweinberger, 2017; Richardson & Watt, 2005). Dieses zunehmende Interesse an Berufswechslerinnen und Berufswechslern (BW) in den Lehrberuf gründet darin, dass sie im Kontext von Lehrpersonenmangel und zunehmender Durchlässigkeit von Ausbildungsgängen zusehends zu einer wichtigen Zielgruppe für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung werden (Marinell & Johnson, 2014).
Im Hinblick auf ihre Vorberufe und Qualifikationen bilden BW eine sehr heterogene Gruppe, da sie oft als Quer- oder Seiteneinsteigende spezielle Ausbildungsprogramme durchlaufen. Wir verwenden an dieser Stelle den weiten Begriff BW, da darunter alle Personen fallen, die vor dem Eintritt ins Lehramtsstudium bereits eine andere Berufsausbildung absolviert haben, ungeachtet spezifischer Rekrutierungs- und Ausbildungskontexte.
BW gelten insgesamt als überdurchschnittlich stark intrinsisch motiviert (z. B. Tigchelaar, Brouwer & Vermunt, 2010; Wilkins & Comber, 2015). Bislang gibt es jedoch kaum Forschung dazu, inwiefern spezifische Facetten früherer Berufstätigkeit die Berufswahlmotivation beeinflussen. Der vorliegende Beitrag versucht, dazu weitere Erkenntnisse zu liefern, und befasst sich mit der Bedeutung des früheren beruflichen Status für die Wahl des Lehrberufs als Zweit- oder Drittberuf. Zwar hat in vielen europäischen Staaten der Lehrberuf in den letzten Jahrzehnten an gesellschaftlichem Ansehen und Status verloren (Rothland, 2016), aus individueller Perspektive jedoch bedeutet die Berufswahl Lehrer/Lehrerin oftmals einen sozialen Aufstieg, was auch einen Grund für den Berufswechsel darstellen könnte.
Mit den Berufswahlmotiven eng verbunden sind die individuellen Berufsziele. Lehramtsstudierende gelten gemeinhin als wenig leistungs- und karriereorientiert (Nieskens, 2009); sie verfolgen vergleichsweise selten längerfristige Karriereziele. Ob dies auch für BW zutrifft, ist bisher weitgehend ungeklärt. Ziel des vorliegenden Beitrages ist es deshalb, Berufswahlmotive und berufliche Ziele von BW und von Erstberuflern und Erstberuflerinnen (EB) sowie die Bedeutung des früheren beruflichen Status zu untersuchen.
1.1Berufswahlmotivation
1.1.1Berufswahlmotivation bei Lehrpersonen im Allgemeinen
Zur Erklärung der Berufswahlmotivation angehender Lehrpersonen wurden diverse Modelle entwickelt (vgl. Rothland, 2014a als Überblick). International bekannt ist insbesondere das FIT-Choice-Modell der Berufswahlmotive (Watt & Richardson, 2007). Diesem Modell zufolge sind sowohl Erwartungen und antizipierte Berufsperspektiven als auch der Wert, der verschiedenen Berufsaspekten (z. B. berufliche Sicherheit, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen) zugeschrieben wird, wichtig für die Entscheidung für oder gegen den Lehrberuf. Die Forschung zur Berufswahlmotivation hat übereinstimmend gezeigt, dass intrinsische Motive bei der Wahl zum Lehrberuf weitgehend überwiegen (Rothland, 2014a). Diese Berufswahlmotive und Zielorientierungen, aber auch Handlungsergebnis-Überzeugungen werden als handlungsleitend und relativ überdauernd klassifiziert (Reichhart, 2018); sie beeinflussen maßgeblich, wie sich angehende Lehrpersonen in Studium und Beruf entwickeln und ob sie im Beruf verbleiben (Watt & Richardson, 2008).
1.1.2Berufswahlmotivation von Berufswechslern/-wechslerinnen in den Lehrberuf
BW gelten als besonders stark intrinsisch motivierte Lehrkräfte (Tigchelaar et al., 2010; Wilkins & Comber, 2015). Studien zeigen allerdings, dass extrinsische Motive unter bestimmten Umständen auch für BW zentral sein können: Neben den üblichen intrinsischen Motiven nennen BW auch eine Verbesserung der Anstellungssituation und das Erreichen eines höheren Bildungsabschlusses als Berufswahlmotive (z. B. Loretz et al., 2017; Weinmann-Lutz, Amman, Soom & Pfäffli, 2006). Gemäß Erwartung-mal-Wert-Modellen kann ein erwarteter Statusgewinn durch einen Berufswechsel als antizipierter Nutzen einer Ausbildung interpretiert werden (Denzler & Wolter, 2008), gleichzeitig ist er ein extrinsisches Motiv der Berufs- bzw. Studienwahl (Watt & Richardson, 2007). Auf dieser Basis wäre zu erwarten, dass ein antizipierter Statusgewinn mit stärkeren extrinsischen Berufswahlmotiven einhergeht, ein erwarteter Statusverlust hingegen durch stärkere intrinsische Motive kompensiert werden muss. Die Ergebnisse von Loretz et al. (2017) bestätigen dies: Extrinsische Motive wie die finanzielle Sicherheit sind vor allem bei BW zentral, die zuvor in Berufen ohne regelmäßiges Einkommen tätig waren (z. B. im Kulturbereich), während sie für BW, die zuvor in Berufen mit hohem Ansehen (z. B. Kader, Management, öffentlicher Sektor) gearbeitet haben, kaum bedeutsam sind. Auch die qualitative Interviewanalyse von Weinmann-Lutz et al. (2006) zeigt, dass verschiedene Facetten des früheren Berufs wie beispielsweise die finanzielle Sicherheit oder der berufliche Status mitentscheiden, welche Motive für die Wahl zur Lehrperson relevant sind. Manche Studien schreiben dem beruflichen Status allerdings keine tragende Rolle zu: In der Studie von Kappeler (2006) nannten nur 5 von 30 befragten Quereinsteigenden den sozialen Aufstieg als Motiv für die Wahl des Lehrberufs. Auch Laming and Horne (2013) und Wilkins und Comber (2015) fanden, dass bei BW der berufliche Status eine eher untergeordnete Rolle bei der Berufswahlmotivation spiele.
Читать дальше