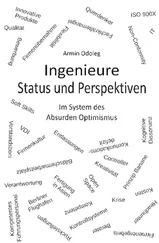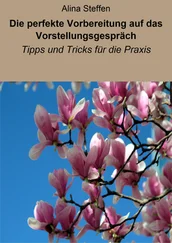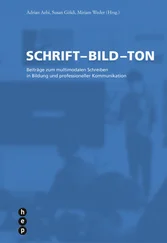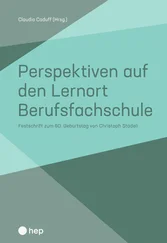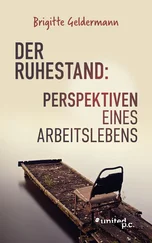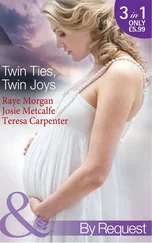Das elektronische Kompetenzentwicklungsportfolio. Ein Reflexionsinstrument zur professionellen Identitätsentwicklung im Lehramtsstudium
Das elektronische Kompetenzentwicklungsportfolio. Ein Reflexionsinstrument zur professionellen Identitätsentwicklung im Lehramtsstudium
(Yvette Völschow, Simone Israel und Julia-Nadine Warrelmann)
Die Reflexion des eigenen professionellen Handelns gilt als zentrales Instrument zur Verknüpfung von theoretischem Wissen und praktischem Handeln in der Grundausbildung. Die Autorinnen zeigen Möglichkeiten der Reflexions- und Reflexivitätsförderung mittels Portfolioarbeit auf mit dem Ziel, die professionelle Identitätsentwicklung zu begleiten.
 Subjektive Eignung und Entschiedenheit für den Lehrberuf: Passt das immer zusammen?
Subjektive Eignung und Entschiedenheit für den Lehrberuf: Passt das immer zusammen?
(Ernst Hany, Nadine Böhme, Tobias Michael und Melanie Keiner)
Dieser Beitrag untersucht auf der Basis einer exploratorischen Studie Zusammenhänge zwischen der Berufseignung und der Sicherheit der Studierenden, die richtige Berufswahl getroffen zu haben, und geht der Frage nach, wie sich diese Erkenntnisse für die Identitätsförderung im Rahmen der Grundausbildung nutzen lassen.
 Berufliche Identitätsbildung als Prozess und Entwicklungsaufgabe im Studium
Berufliche Identitätsbildung als Prozess und Entwicklungsaufgabe im Studium
(Julia Košinár)
Welche Berufsrolle Lehrpersonen sich zuschreiben, ist für ihr professionelles Handeln von zentraler Bedeutung. Der Beitrag beleuchtet, wo die Grundlagen der Entwicklung einer professionellen Identität zu lokalisieren sind, wie Prozesse der beruflichen Identitätsbildung verlaufen und welche Bedingungsfaktoren dabei bedeutsam sind.
Teil 2: Einstieg in den Lehrberuf
Im zweiten Themenbereich sind Beiträge zusammengefasst, die schwerpunktmäßig den Übergang von der Grundausbildung in den Beruf und/oder die Anforderungen der ersten Berufsjahre in den Fokus rücken.
 Gut begonnen, halb gewonnen? Die Bedeutung der Berufseinstiegsphase von Lehrpersonen für die Entwicklung des beruflichen Belastungserlebens
Gut begonnen, halb gewonnen? Die Bedeutung der Berufseinstiegsphase von Lehrpersonen für die Entwicklung des beruflichen Belastungserlebens
(Victoria Bleck, Tatjana Weber und Frank Lipowsky)
Der Lehrberuf ist geprägt von einem hochkomplexen Aufgabenprofil und gilt als Beruf mit hohem Risiko der beruflichen Belastung. Doch bleibt langfristig belastet, wer sich im Berufseinstieg überfordert fühlt? Diese Längsschnittstudie begleitet Lehrkräfte vom Berufseinstieg in die mittlere Berufsphase hinein und untersucht, wie sich das subjektive Belastungserleben im Verlauf der Jahre verändert.
 Schützt Selbstregulation vor emotionaler Erschöpfung? Subjektive Belastung und personale Ressourcen von Lehrpersonen am Ende der Berufseinstiegsphase
Schützt Selbstregulation vor emotionaler Erschöpfung? Subjektive Belastung und personale Ressourcen von Lehrpersonen am Ende der Berufseinstiegsphase
(Simone Berweger, Andrea Keck Frei, Zippora Bürrer, Christine Wolfgramm und Christine Bieri Buschor)
Die Fähigkeit, eigene Handlungen und Emotionen zu steuern, ist eine zentrale Kompetenz im Umgang mit komplexen Anforderungen, die vor negativen Belastungsfolgen wie emotionaler Erschöpfung und Burn-out schützt. Die Autorinnen untersuchen die Zusammenhänge zwischen subjektivem Belastungserleben, Arbeitszufriedenheit und negativen Belastungsfolgen zwei bis vier Jahre nach Berufseintritt.
 Kompetent und motiviert in den Lehrberuf
Kompetent und motiviert in den Lehrberuf
(Daniela Freisler-Mühlemann und Yves Schafer)
Trotz langjähriger Ausbildung steigen nach der Diplomierung nicht alle ausgebildeten Lehrkräfte direkt in den Lehrberuf ein. Die Autorinnen gehen der Frage nach, ob diese Entscheidung mit geringeren Kompetenzen oder Ressourcen der Nichteinsteiger und Nichteinsteigerinnen zusammenhängt.
 Beginning Teachers’ Engagement Profiles across Four Country Settings: Implications for Teacher Education and Early Career Induction
Beginning Teachers’ Engagement Profiles across Four Country Settings: Implications for Teacher Education and Early Career Induction
(Paul W. Richardson and Helen M. G. Watt)
Berufseinführungsprogramme haben im englischen Sprachraum eine lange Tradition und gewinnen auch in deutschsprachigen Ländern zunehmend an Bedeutung. Das australische Forscherteam beleuchtet die Frage, ob sich anhand ihrer Berufswahlmotive unterschiedliche Typen von Berufseinsteigenden identifizieren lassen, was dies für die weitere professionelle Entwicklung bedeutet und wie die Berufseinführung darauf reagieren kann.
Teil 3: Perspektiven im Lehrberuf
Der dritte Teil umfasst Beiträge, die über den Berufseinstieg hinausblicken und sich schwerpunktmäßig mit dem Berufsverbleib und den Berufszielen von Lehrkräften befassen.
 Passion für den Lehrberuf, Commitment und Kompetenzentwicklung: Absichten zum Verbleib im Lehrberuf von quereinsteigenden Lehrpersonen
Passion für den Lehrberuf, Commitment und Kompetenzentwicklung: Absichten zum Verbleib im Lehrberuf von quereinsteigenden Lehrpersonen
(Mirjam Kocher, Andrea. Keck Frei, Christine Bieri Buschor und Ramona Hürlimann)
Quereinsteigende gelten als besonders stark intrinsisch motiviert – doch ob sie langfristig im neuen Beruf verbleiben oder anfällig sind, rasch wieder aus dem Beruf auszusteigen, ist noch wenig untersucht. Vor diesem Hintergrund berichtet dieser Beitrag Ergebnisse einer Längsschnittstudie, welche die berufliche Entwicklung und die Verbleibsabsichten von Quereinsteigenden fokussiert.
 Lehrpersonen unterrichten – oder nicht? Berufspläne von Quereinsteigenden im Vergleich zu Regelstudierenden
Lehrpersonen unterrichten – oder nicht? Berufspläne von Quereinsteigenden im Vergleich zu Regelstudierenden
(Kirsten Schweinberger und Netkey Safi)
Berufliche Ziele sind für die Verbleibsabsichten von großer Bedeutung. Die Studie untersucht, welche Berufspläne Quereinsteigende und Regelabsolvierende im Berufseinstieg haben, wie sich diese verändern und welche Bedingungsfaktoren mit einer langfristigen Verbleibsabsicht zusammenhängen.
 Kündigende Lehrpersonen – belastet, unzufrieden oder die Berufslaufbahn gestaltend?
Kündigende Lehrpersonen – belastet, unzufrieden oder die Berufslaufbahn gestaltend?
(Manuela Keller-Schneider)
Kündigung und Berufsausstieg werden oft mit hohen Belastungen in Verbindung gebracht. Doch sind kündigende Lehrkräfte wirklich besonders stark von beruflichen Belastungen betroffen – oder verfolgen sie proaktiv ihre beruflichen Ziele, die sie möglicherweise aus dem Lehrberuf hinausführen? Die Autorin untersucht diese Frage und diskutiert unterschiedliche Kündigungsprofile.
 The Changing Face of the Teaching Force in the United States of America
The Changing Face of the Teaching Force in the United States of America
(Richard Ingersoll, Elizabeth Merrill, Daniel Stuckey and Gregory Collins)
Das Lehrpersonal in den USA wurde über die letzten Jahre gleichzeitig älter und jünger, heterogener bezüglich der kulturellen Herkunft und vor allem eines: zahlenmäßig stärker. Dieser zweite englischsprachige Beitrag setzt einen Schlusspunkt mit einem Überblick zu den Trends der Lehrerinnen- und Lehrerbildung in den USA. Der Blick über den Atlantik ist für das deutschsprachige Forschungs- und Praxisfeld daher von großem Interesse, weil sich diverse der identifizierten Entwicklungen auch im deutschen Sprachraum abzeichnen.
Читать дальше
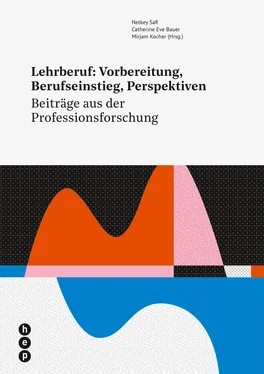
 Das elektronische Kompetenzentwicklungsportfolio. Ein Reflexionsinstrument zur professionellen Identitätsentwicklung im Lehramtsstudium
Das elektronische Kompetenzentwicklungsportfolio. Ein Reflexionsinstrument zur professionellen Identitätsentwicklung im Lehramtsstudium