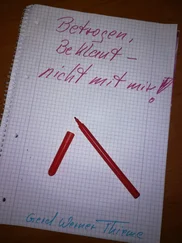Der 24. Juli rückte immer näher. Einen Plan zu erstellen, war das eine, aber ihn auch umzusetzen, war dann doch noch einmal ein großer Schritt, besonders da der Plan aus der Verzweiflung geboren war. Ich war nervös. Wir waren alle nervös. Doch es half nichts. Wir mussten handeln.
Wieder saß ich mit Raimund an unserem Wohnzimmertisch. Die Kinder hatten wir schon zu Bett gebracht und nun grübelten wir. Wir hatten die Fenster geschlossen und die Vorhänge zugezogen, und wir sprachen instinktiv leiser als sonst, ohne uns dessen richtig bewusst zu sein.
»Wohin gehen wir?«, fragte ich.
Raimund nickte. Das war der Punkt. Eine Antwort hatte er auch nicht parat.
»In ein Hotel?«
Raimund dachte nach.
»Zu Freunden?«
»Wem können wir das zumuten, wenn uns die Polizei auf den Fersen ist?«, sagte er.
»Genau. Und wer hält dann dicht?«
»Ich nehme jedenfalls Urlaub«, sagte er.
Damit stand unversehens die Frage im Raum, wie lange unsere Flucht dauern würde. Dieser Frage wollten wir uns jetzt nicht stellen. Es ging vorerst um das Notwendigste. Hier konnten wir nicht bleiben. Wohin sollten wir gehen? Alles andere würde sich finden. Das Gefühl, das Richtige zu tun, gab uns Hoffnung, dass diese Episode bald vorbeigehen würde. Mir wäre es am liebsten gewesen, ein Versteck in der Nähe unseres Hauses zu finden, doch da gab es ein Problem. Wegen einer Unterschriftenaktion, die Freunde zu meiner Unterstützung organisiert hatten, war die Sache zuerst in die Regionalmedien gelangt, und schließlich waren auch die großen Tageszeitungen und das Fernsehen auf uns aufmerksam geworden. Nachdem der erste Beitrag einer überregionalen Tageszeitung erschienen war, meldete sich Ludwig bei mir. Er hatte mich einfach im Telefonbuch gesucht, war auf meine Tante gestoßen und über sie zu mir vorgedrungen. Ludwig betrieb eine kleine Presseagentur, die sich auf Boulevardthemen spezialisiert hatte und laut ihrer Homepage Medien wie »Bild«, den Schweizer »Blick«, die britische »Sun« und »Österreich« mit Recherchen und Beiträgen versorgte.
»Wir sollten zusammenarbeiten«, sagte Ludwig mit seiner rauchigen Stimme. »Ich kann Ihnen helfen. Ich habe einige Erfahrungen mit derartigen Fällen. Ich hatte einen ähnlichen, bei dem es um Kolumbien ging.«
»Was wollen Sie dafür von mir?«, fragte ich.
»Nichts«, sagte er. »Ich bekomme die Storys und Sie die Öffentlichkeit. Sie haben das letzte Wort. Ich tue nichts, das Ihnen schaden könnte.«
Ich war völlig ahnungslos in diesen Dingen, doch ohne zu wissen, warum, hatte ich das Gefühl, dass es Ludwig ehrlich mit mir meinte. Vermutlich funktionierte sein Geschäftsmodell wie die meisten auch nur, wenn er ehrlich war. »Wir können es ja versuchen«, sagte ich.
Von da an hatte ich einen Medienprofi an meiner Seite, der abgebrüht war und gleichzeitig tatsächlich sorgsam mit der medialen Seite meines Schicksals umging. Das bedeutete aber auch, dass unsere Gesichter landesweit bekannt wurden. Die Polizisten würden uns umso eher erkennen.
Es machte mir Mut, dass wir mit unserem Problem nicht allein waren. Trotzdem stieg der Druck zu Hause stetig, bis ich es nicht mehr aushielt. »Wir machen Urlaub im Waldviertel«, entschied ich, nachdem ich einen Tag lang mit summendem Kopf im Haus auf und ab gelaufen war, und die Stimmen der Kinder sich mit der Intensität von Sirenen in mein Bewusstsein gebohrt hatten.
Ein paar Tage am Land zwischen den dichten Wäldern und den Äckern weit nördlich der Donau würden uns allen gut tun. Wir würden Kraft tanken, für den 24. Juli und für alles, was danach kommen würde. Etwas zu planen, war mir zudem schon immer außerhalb meiner vertrauten Umgebung am leichtesten gefallen. »Vorsorglich verwischen wir schon einmal unsere Spuren«, sagte ich zu Raimund. Das bedeutete, dass wir einen anderen Wagen und andere Handys brauchten und von nun an kein Plastikgeld mehr verwenden durften.
Ich packte zwei riesige Koffer. Zwar war ich es gewohnt, uns auch auf längere Urlaube vorzubereiten, aber diesmal war die Situation eine andere. Dieser Urlaub bedeutete den Anfang einer möglicherweise langen Flucht. Es waren nur noch wenige Tage bis zum 24. Juli, und ich hielt es für möglich, dass wir dazwischen nicht mehr nach Hause zurückkehren würden.
Der Moment des Packens erschien mir wie eine Ewigkeit. Ich konnte nicht anders, als beim Zusammenlegen der Wäsche ständig an Sofias Hemdchen und Pullovern zu schnuppern. Mich überkam immer wieder das Gefühl, als wären beide Koffer nur für sie, als wäre sie schon erwachsen geworden und dabei, von zu Hause weg zu gehen, hinaus in die weite und gefährliche Welt. Zugleich beschlich mich die Besorgnis, unser Haus vielleicht für immer verlassen zu müssen. Doch ein Entschluss, der aus der Verzweiflung geboren ist, entwickelt eine seltsame Kraft des Faktischen. Weil ich keine Alternativen sah, fühlte sich mein Plan wie Schicksal an, und alles, was mir blieb, war, dabei die Haltung zu bewahren.
Wir fuhren zu einem hübschen kleinen Hotel in der Nähe des Ottensteiner Stausees, in dem wir ein großes Familienzimmer hatten und von dem aus wir Bootsfahrten, Radfahrten und Ausflüge zu den Mohnfeldern machen konnten. Ein guter Ort für Kinder. Sie entspannten sich ein wenig. Raimund und ich sorgten für Beschäftigung. Wir genossen unser gefährdetes Familienglück in vollen Zügen. Ich kannte das Ablaufdatum, doch um nicht daran zu denken, stürzte ich mich umso mehr in den Moment und genoss die Tage wie schon lange nicht mehr. Es lag eine merkwürdige Leichtigkeit darin, alles hinter sich zu lassen, das alte Leben, das alte Zuhause, und auch die schreckliche Verpflichtung, Sofia den Behörden zu überlassen.
Sofia lernte wieder lachen. Ihr zuzusehen, wie sie auf der Wiese in der Sommersonne herumtollte und in ihren Kinderfantasien versank, löste in mir zum ersten Mal seit Langem wieder ein kleines Glücksgefühl aus. Sie so zu sehen, gab mir Kraft. Sie plauderte mit den Schmetterlingen und Hummeln und tänzelte durch das hohe Gras. Sie war abgelenkt und zufrieden, ganz anders als noch vor wenigen Tagen in unserem Haus in Berndorf, und ihre Ruhe strahlte auf uns alle ab.
Das war die eine Seite. Die andere holte mich nachts in meinen Träumen ein. Obwohl es nur ein Kurzurlaub war, fühlte ich mich jetzt schon wie eine Untergrundkämpferin. Bisher hatte ich solche Geschichten nur aus Büchern und dem Kino gekannt. Raimund und ich hatten unsere Handys zu Hause gelassen und uns stattdessen Wertkartenhandys zugelegt. Die neuen Nummern hatten wir nur ausgewählten Menschen gegeben. Menschen, denen wir zu hundert Prozent vertrauten. Das waren meine Mutter, meine beste Freundin, meine Freundin Karoline, die ein ähnliches Schicksal hatte wie ich, und meine neue Anwältin Astrid.
Wir verwendeten unsere Bankomatkarten nicht mehr. Raimund hatte auch ein neues Auto besorgt. Jetzt fuhren wir einen silbernen Škoda.
Als mein neues Wertkartenhandy zum ersten Mal läutete, war unsere Anwältin Astrid dran. Dass wir trotz unserer inzwischen erschöpften finanziellen Möglichkeiten überhaupt eine Anwältin hatten, verdankten wir Ludwig. Er brachte mich mit dem Verein »helphilft« in Kontakt, dessen Obmann Christian war. Christian engagierte sich mit seinem Verein eigentlich in Asylfragen, doch er war bereit, auch für mich etwas zu tun. »Ich kann dir eine Anwältin besorgen«, sagte er. »Das ist das Erste, was du jetzt brauchst.«
»Mein Budget ist inzwischen leider äußerst begrenzt«, sagte ich. »Besser gesagt, es ist gar nicht vorhanden.«
»Mach dir darüber erst einmal keine Gedanken«, sagte Christian. »Das kriegen wir schon irgendwie hin.«
Obwohl mein Vertrauen der Welt gegenüber in den letzten Jahren beträchtlich gesunken war, hatte ich auch bei Christian von Anfang an das Gefühl, in guten Händen zu sein. Dasselbe galt auch für Astrid. Sie war eine drahtige Frau mit braunen Haaren in mittleren Jahren, die abwinkte, als ich bei unserem ersten Treffen das heikle Thema Honorar ansprach. »Jetzt sehen wir einmal zu, dass deine Sache wieder in Ordnung kommt«, sagte sie.
Читать дальше