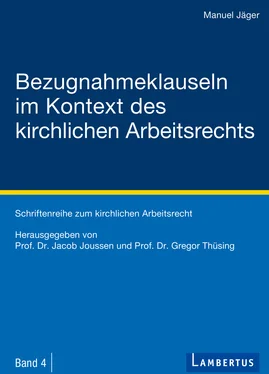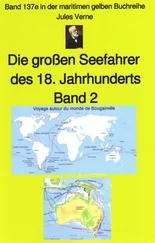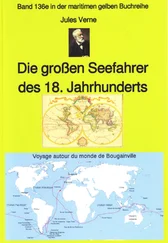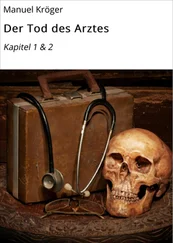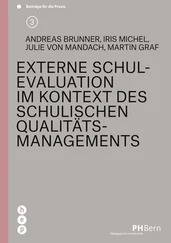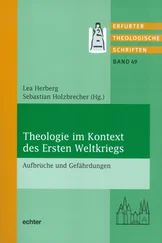Das liegt zunächst daran, dass auch im Tarifvertragsrecht bei fehlender Verbandsmitgliedschaft einer Arbeitsvertragspartei ein Tarifvertrag nur einzelvertraglich durch Inbezugnahme des Tarifvertrages zur Geltung gelangt. 177Daher lässt sich auch nicht mit einem Beitritt zur Gewerkschaft die Anerkennung einer normativen Wirkung kollektivrechtlicher Regelungswerke begründen.
Zudem kann aus dem Abschluss eines Dienstverhältnisses kein Unterwerfungsakt hergeleitet werden, der zu einer normativen Wirkung der AVR führt. Es fehlt regelmäßig sowohl am äußeren Tatbestand einer Unterwerfungserklärung als auch am spezifischen Erklärungsbewusstsein. 178Zwar hat ein Dienstnehmer durch Abschluss eines Dienstvertrages die Möglichkeit der Teilhabe am Beschluss einer Arbeitsrechtlichen Kommission. Dies genügt jedoch ebenso wenig wie der bloße Verbandsbeitritt im Tarifvertragsrecht, um eine Rechtsnormqualität der AVR zu begründen. Durch den Abschluss des Dienstvertrages gibt der einzelne Dienstnehmer nach außen lediglich zu erkennen, dass er die Regeln zur Beschlussfassung kirchlicher Arbeitsbedingungen akzeptiert. Darin einen Normunterwerfungsakt zu sehen, der letztlich eine normative Wirkung der Arbeitsbedingungen des „Dritten Weges“ legitimiert, würde jedoch zu weit gehen. Die inhaltliche Unterwerfung unter die konkreten Arbeitsrechtsregelungen erfordert jedoch einen weiteren erkennbaren Gestaltungsakt, wie etwa die Vereinbarung einer Bezugnahmeklausel.
Darüber hinaus kann auch aus der Rechtsfigur des Gestaltungsrechts keine Normsetzungsbefugnis der Arbeitsrechtlichen Kommission hergeleitet werden. Ein derartiges Gestaltungsrecht käme dem Leistungsbestimmungsrecht eines Dritten nach § 317 BGB gleich.
Ein Leistungsbestimmungsrecht eines Dritten nach § 317 BGB kann aber in doppelter Hinsicht nicht als Legitimation einer Rechtsnormqualität der AVR überzeugen. Voraussetzung ist zunächst, dass die paritätisch aus Dienstnehmer- und Dienstgebervertretern zusammengesetzten Arbeitsrechtlichen Kommissionen, trotz der widerstreitenden Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinteressen und dem Rückgriff auf eine Schlichtungskommission im Konfliktfall, als „einheitlicher Dritter“ verstanden werden. 179Stellt man auf den Gedanken der Dienstgemeinschaft ab, mag sich die Arbeitsrechtliche Kommission noch als „einheitlicher Dritter“ konstruieren lassen. In der Praxis kann aber wegen der zwischen Dienstgeber- und Dienstnehmerseite teils sehr kontrovers diskutierten und verhandelten gegensätzlichen Standpunkte, die Arbeitsrechtliche Kommission nicht als „einheitlicher Dritter“ angesehen werden. Das Modell des Gestaltungsrechts weist darüber hinaus eine weitere Schwäche auf: Der „Dritte“ nach § 317 Abs. 1 BGB hat die Leistungsbestimmung im Zweifel nach „billigem Ermessen“ auszuüben. Arbeitsbedingungen nach „billigem Ermessen“ stehen aber im Widerspruch zum christlichen Selbstverständnis und insbesondere zu dem Ziel der paritätisch ausgehandelten Arbeitsrechtsregelungen. 180
Auch die letzte Begründung des privatrechtlichen Ansatzes, die Rechtsfigur einer sachlich und zeitlich begrenzten unwiderruflichen Ermächtigung, kann nicht als Begründung einer normativen Wirkung des „Dritten Weges“ überzeugen. Diese Ermächtigungskonstruktion sieht in dem Erlass der Arbeitsbedingungen der Arbeitsrechtlichen Kommissionen den Abschluss eines schuldrechtlichen Vertrages, der Wirkungen für und gegen die Dienstnehmer erzeugen soll. Diese Konstruktion würde jedoch zu einer dem BGB fremden „Verpflichtungsermächtigung“ führen, bei der es sich anders als bei der Verfügungsermächtigung um eine unzulässige Rechtsfigur handelt. 181
b)Stellungnahme zur Auffassung in der Rechtsprechung
Die Senate des BAG haben zwar in keiner Entscheidung ausdrücklich eine Rechtsnormqualität kirchlicher Arbeitsbedingungen des „Dritten Weges“ angenommen. Dennoch weist die Rechtsprechung des BAG durch einzelne Entscheidungen, in denen eine mögliche normative Wirkung in Betracht gezogen wurde, eine gewisse Inkonsequenz auf. Im Ergebnis kann der vom BAG eingeschlagene Weg jedoch überzeugen. Ohne Anordnung im säkularen Arbeitsrecht können die AVR des „Dritten Weges“ keine normative Wirkung entfalten.
Zuzustimmen ist der Rechtsprechung des BAG insbesondere hinsichtlich der Ausführungen zur Reichweite des Selbstbestimmungsrechts. Aus diesem kann nämlich keine Kompetenz hergeleitet werden, die es den Kirchen gestattet, eine normative Wirkung der AVR für nach säkularem Arbeitsrecht abgeschlossene Dienstverträge anzuordnen. Da die Kirchen hierbei auf das staatliche Recht zurückgreifen, ist die Grenze der eigenen Angelegenheiten überschritten. Dementsprechend obliegt es nur dem weltlichen Gesetzgeber, eine normative Wirkung für die kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen anzuordnen. Diese Auffassung steht auch im Einklang mit dem grundlegenden Beschluss des Bundesverfassungsgerichts 182aus dem Jahre 1985. Schließlich wurde hier bereits festgelegt, dass die Kirchen – sofern sie sich für eine privatrechtliche Ausgestaltung ihrer Dienstverhältnisse entscheiden – zwar die Möglichkeiten des privaten Rechts nutzen können, aber auch an dessen Grenzen gebunden sind.
Insoweit thematisiert die Rechtsprechung den in der Literatur vertretenen öffentlich-rechtlichen Ansatz und lehnt diesen zutreffend ab. Unzureichend ist hingegen die Auseinandersetzung mit dem privatrechtlichen Erklärungsmodell der Literatur. In keinem der dargestellten Urteile wird auf diesen Ansatz eingegangen. Auch wenn das privatrechtliche Modell im Ergebnis nicht als Begründung herhalten kann, hätte dieser Ansatz von der Rechtsprechung aufgegriffen und thematisiert werden müssen.
Solange der weltliche Gesetzgeber nicht aktiv wird und die Rechtsnormqualität kirchlicher Arbeitsbedingungen des „Dritten Weges“ im säkularen Recht anordnet, erhalten die AVR keine normative Geltung im kirchlichen Arbeitsrecht. Daher sind kirchliche Anstellungsträger auf die Verwendung von Bezugnahmeklauseln angewiesen. Folglich ist auch im Rahmen des „Dritten Weges“ in nahezu jedem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis, das ein Dienstgeber mit einem designierten Dienstnehmer schließt, die Vereinbarung einer Bezugnahmeklausel erforderlich, um den AVR Geltung zu verleihen.
Dieses Ergebnis spiegelt einmal mehr das Bedürfnis nach einer umfassenden Darstellung der Bezugnahmeklauseln im Kontext des kirchlichen Arbeitsrechts wider.
95 Richardi , Arbeitsrecht in der Kirche, S. 66 f.
96Ausführlich zur Interessenpolarität zwischen Dienstgebern und Dienstnehmern: Keßler , Die Kirchen und das Arbeitsrecht, S. 232 ff.; Ensinger , Betriebliche Mitbestimmung in Kirche und Diakonie, S. 63.
97Beispielsweise entsteht ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis eines kirchlichen Arbeitnehmers zu seinem Arbeitgeber, wenn im ländlichen Bereich eine große kirchliche Einrichtung eine Monopolstellung auf dem Arbeitsmarkt innehat, vgl. Lienemann , Kirchlicher Dienst zwischen kirchlichem und staatlichem Recht, S. 506; Ensinger , Betriebliche Mitbestimmung in Kirche und Diakonie, S. 63.
98Ausführlich MAVO/ Thiel Präambel Rn. 76 ff. Überblick über diözesanen Abweichungen einzelner Mitarbeitervertretungsordnungen in MAVO/ Thiel Präambel Rn. 11.
99Siehe unten 5. Kapitel B.
100BVerfG v. 04.06.1985 – 2 BvR 1703/83, BVerfGE 70, S. 138; BAG v. 24.04.2013 – 2 AZR 579/12, NJW 2014, S. 104; BAG v. 20.11.2012 – 1 AZR 179/11, NZA 2013, S. 448; BAG v. 20.11.2012 – 1 AZR 611/11, NZA 2013, S. 437; v. Campenhausen/de Wall , Staatskirchenrecht, S. 184; Klumpp , ZAT 2015, S. 181 (181); Schubert , RdA 2011, S. 270 (274).
Читать дальше