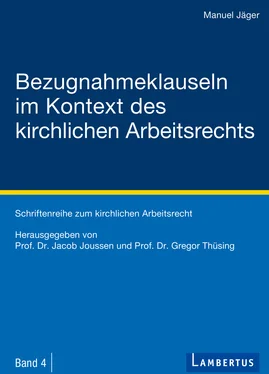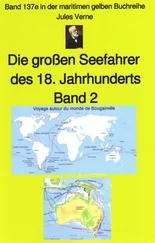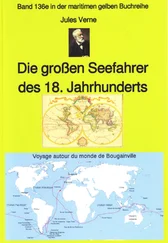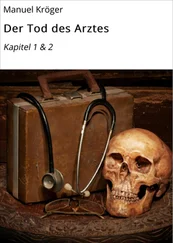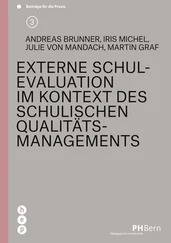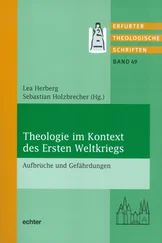Vorrangig werden kirchliche Arbeitsrechtsregelungen im Rahmen des „Dritten Weges“ abgeschlossen. In einer paritätisch besetzten arbeitsrechtlichen Kommission beraten und beschließen gewählte Vertreter von Dienstgeberund Dienstnehmerseite über die kollektivrechtlichen Arbeitsbedingungen für die in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden kirchlichen Einrichtungen, sog. Arbeitsrechtliche Kommission. 109Bei diesen so geschaffenen Arbeitsbedingungen handelt es sich nach ständiger Rechtsprechung des BAG nicht um Tarifverträge nach dem TVG, da sie nicht nach dessen Maßgabe zustande gekommen sind. 110Das BAG stuft die Arbeitsvertragsregelungen des „Dritten Weges“ vielmehr als „Kollektivvereinbarungen besonderer Art“ ein. 111Es handelt sich dabei also um eine Möglichkeit, Arbeitsrechtsregelungen zu setzen, die weder einzelvertraglich noch mittels eines weltlichen Tarifvertrages vereinbart werden.
Mit Ausnahme der konkreten Art der Zusammensetzung der Arbeitsrechtlichen Kommissionen ist der „Dritte Weg“ in evangelischer und katholischer Kirche vergleichbar aufgebaut. Kernstück des Arbeitsrechtsregelungsverfahrens nach dem „Dritten Weg“ ist die Arbeitsrechtliche Kommission. Die Funktion des durch Kirchenrecht geschaffenen Gremiums besteht darin, Normen zu beschließen, die Regelungen zum Abschluss, Inhalt und zur Beendigung des Individualarbeitsverhältnisses enthalten. Damit hat die Arbeitsrechtliche Kommission dem Grunde nach die gleiche Zuständigkeit wie die Tarifvertragsparteien bei Abschluss eines Tarifvertrages. 112Die paritätische Besetzung der Arbeitsrechtlichen Kommission ist ein Ausfluss der Dienstgemeinschaft.
Bezüglich der Zusammensetzung der Arbeitsrechtlichen Kommissionen legt § 8 ARGG für die evangelische Kirche fest, dass die Dienstnehmervertreter in der paritätischen Kommission aus Mitarbeiterverbänden und Gewerkschaften entsendet werden, sog. Verbandsgrundsatz in der evangelischen Kirche. Dagegen sieht die katholische Kirche für die Besetzung der Dienstnehmervertretung in der Arbeitsrechtlichen Kommission eine demokratisch legitimierte Repräsentation vor. Die Mitarbeiter wählen ihre Vertreter aus den verschiedenen Gruppen des kirchlichen Dienstes, § 6 Abs. 1 Regional-/Bistums-KO-DA-Ordnung bzw. § 4 AK-Ordnung Caritas. Darüber hinaus können die Gewerkschaften Mitglieder benennen und entsenden, § 6 Abs. 2 i. V. m. § 9 Regional-/Bistums-KODA-Ordnung, bzw. § 5 AK-Ordnung Caritas.
Dem „Dritten Weg“ liegt eine Friedenspflicht zugrunde, die sich in dem Ausschluss des Streikrechts manifestiert. Nach § 7 Abs. 2 S. 2 GrOkathK scheiden Streik und Aussperrung in der katholischen Kirche aus. In der evangelischen Kirche ist in § 3 ARGG normiert, dass den Arbeitsrechtsregelungsverfahren ein „Konsensprinzip“ zugrunde liegt, das einen Arbeitskampf ausschließt. Im Konfliktfall ist eine Entscheidung durch einen Schlichtungsausschuss vorgesehen.
Die über den „Dritten Weg“ zustande gekommenen Arbeitsbedingungen werden regelmäßig als Arbeitsvertragsrichtlinien oder Arbeitsvertragsordnungen (im Folgenden einheitlich als AVR) bezeichnet.
Im Rahmen der verfassungsrechtlichen Selbstbestimmungsgarantie ist es den Kirchen freigestellt, selbst zu entscheiden, in welcher Beteiligungsform sie die Maximen der überbetrieblichen Mitbestimmung verwirklichen. Daher haben sie auch die Möglichkeit, im Rahmen des „Zweiten Weges“ Tarifverträge mit Gewerkschaften abzuschließen, die nach den Regelungen des weltlichen TVG zustande kommen. Maßgebliche Modifikation dieser Tarifverträge ist der vom BAG – unter Auflagen – für zulässig befundene Ausschluss von Arbeitskampfmaßnahmen. 113Auch dem „Zweiten Weg“ liegt der Leitgedanke einer Dienstgemeinschaft zugrunde, was dazu führt, dass im Rahmen kirchlicher Tarifverträge ebenfalls eine absolute Friedenspflicht herrscht. An die Stelle von Streik und Aussperrung tritt bei Uneinigkeit der Tarifvertragsparteien die Durchführung eines Schlichtungsverlangens. Im Konfliktfall hat dann eine Lösung durch eine paritätisch besetzte Schlichtungskommission stattzufinden. 114Der „Zweite Weg“ ist allerdings nur in der evangelischen Kirche möglich, vgl. §§ 13, 14 ARGG. In der katholischen Kirche ist der Abschluss von Tarifverträgen dagegen gem. § 7 Abs. 2 S. 1 GrOkathK ausgeschlossen.
Die Wirksamkeit eines kircheneigenen Tarifvertrages richtet sich grundsätzlich nach den Anforderungen des weltlichen Arbeitsrechts, da Tarifverträge des „Zweiten Weges“ nach Maßgabe des TVG zustande kommen. Kirchliche Anstellungsträger sind an die dort festgelegten Regelungskompetenzen gebunden. Folglich erhält eine zwischen kirchlichen Dienstgebern und Gewerkschaft getroffene Vereinbarung ausschließlich dann die Anerkennung als Tarifvertrag, wenn sie den Anforderungen des TVG entspricht. 115Das führt aber nicht dazu, dass sich ein Tarifvertrag des „Zweiten Weges“ in das säkulare Tarifsystem einreiht; vielmehr bleibt es auch im Rahmen des Beteiligungsmodells des „Zweiten Weges“ bei einem ausschließlich den Kirchen zustehenden System der überbetrieblichen Mitbestimmung, um kollektive Arbeitsbedingungen auszuhandeln und zu beschließen. 116
III.Anwendung des „Zweiten und Dritten Weges“ im kirchlichen Arbeitsrecht
Die katholische Kirche lehnt den Abschluss von Tarifverträgen im Rahmen des „Zweiten Weges“ konsequent ab. Normiert ist dies in § 7 Abs. 2 GrOkathK. Danach schließt die katholische Kirche „wegen der Einheit des kirchlichen Dienstes und der Dienstgemeinschaft als Strukturprinzip“ keine Tarifverträge mit Gewerkschaften ab. Anlässlich der Diskussion 117über den „Dritten Weg“ der Kirchen im Arbeitsrechtsregelungsverfahren hat die katholische Kirche dieses Verständnis auch in der von Dienstnehmer- und Dienstgebervertretern verfassten „Magdeburger Erklärung der Zentral-KODA“ aus dem Jahre 2011 deutlich hervorgehoben. 118Darin heißt es unter anderem, dass durch das System des „Dritten Weges“ sichergestellt werde, dass selbst ein Dienstnehmer in kleineren kirchlichen Einrichtungen in den Genuss des durch den „Dritten Weg“ gewährten tariflichen Standards komme. 119In der Folge sind in der katholischen Kirche ausschließlich AVR, die über den „Dritten Weg“ zustande gekommen sind, als Bezugnahmeobjekte der Bezugnahmeklauseln denkbar.
Demgegenüber sind in der evangelischen Kirche sowohl Arbeitsrechtsregelungen, die über den „Zweiten Weg“, als auch solche, die über den „Dritten Weg“ zustande gekommen sind, als Bezugnahmeobjekte der Bezugnahmeklauseln möglich. Nach § 13 Abs. 1 ARGG stellen die Verfahren des „Zweiten und Dritten Weges“ neuerdings zwar eine gleichberechtigte Möglichkeit dar, kollektivrechtliche Arbeitsbedingungen zu schaffen. 120In der Praxis der evangelischen Kirche gebührt dem „Dritten Weg“ jedoch (noch) der Vorzug. Dieser Umstand basiert vorrangig darauf, dass in dem bis 2013 geltenden Arbeitsrechtsregelungsgesetz der EKD (ARRG-EKD) 121allein ein Arbeitsrechtsregelungsverfahren im Rahmen der überbetrieblichen Mitbestimmung nach dem „Dritten Weg“ vorgesehen war. So wurde der Abschluss von kirchlichen Tarifverträgen zwar bis zum Erlass des ARGG toleriert, basierte aber zu keiner Zeit auf einer kirchengesetzlichen Ermächtigung.
Vor der Gleichstellung von „Zweitem und Drittem Weg“ durch das ARGG haben nur die Nordelbische Landeskirche 122sowie die Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg 123einen Tarifvertrag abgeschlossen. Die Einführung des Wahlrechts zwischen „Zweitem und Drittem Weg“ im ARGG hat nunmehr dazu geführt, dass sich auch die Diakonie in Niedersachsen auf einen Tarifvertrag mit einer Gewerkschaft geeinigt hat. 124Dieser Tarifvertrag der Diakonie Niedersachsen (TV DN) wurde zwischen dem Diakonischen Dienstgeberverband Niedersachsen e. V. (DDN) und der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) am 19.09.2014 geschlossen.
Читать дальше