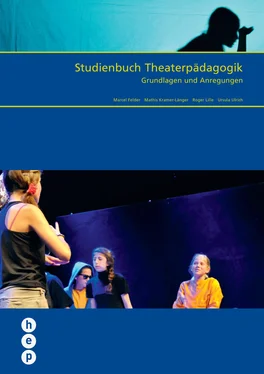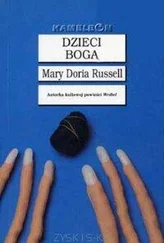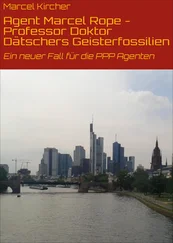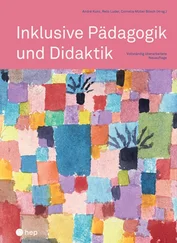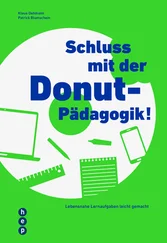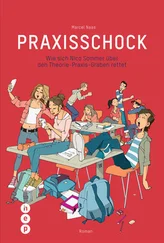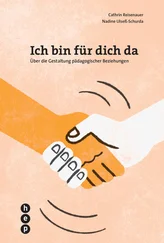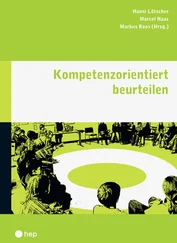1 ...7 8 9 11 12 13 ...19 1.6 DRAMA IN EDUCATION ODER: VOM ENGLISCHEN SELBSTVERSTÄNDNIS
Neben den genannten Lehrmeistern, die vor allem schauspielerische Vorgänge untersuchten und dadurch viel für das Verständnis von Spielprozessen beitrugen, entwickelten sich auch neue Arbeitsfelder, in denen professionelle Theaterleute mit Kindern und Jugendlichen im schulischen oder ausserschulischen Bereich arbeiteten. Eine Vorreiterrolle übernahm England, wo sich bereits in den 1950er-Jahren das ‹Drama in Education› als methodisches Prinzip entwickelte und sich über Skandinavien und die Niederlande auch im deutschsprachigen Raum etablierte. ‹Drama in education› hat – im Gegensatz zu ‹drama education› – nichts mit der klassischen dramatischen Literatur und deren szenischer Umsetzung zu tun. Mit ‹Drama in Education› wird vielmehr ein Arbeitsprinzip umschrieben, das mittels eigenen Theaterspiels soziale Realitäten untersuchen, hinterfragen und über Spielprozesse auch beeinflussen will. Ursprünglich arbeiteten Theaterpädagogen – drama teacher – mit Schülerinnen und Schülern einer Klasse im Rahmen von ‹als-ob› -Situationen an der Bewusstwerdung der sozialen und gesellschaftlichen Rollen. Später weitete sich der Begriff aus; er umfasst heute interaktives Spiel auf allen Ebenen von Persönlichkeits- und Identitätsentwicklung. Das Ziel ist aber immer noch der subjektive Erkenntnisgewinn. Es geht um Sozialkompetenz und Teamfähigkeit. Im Mittelpunkt steht das interaktive Spiel der Teilnehmenden an sich und nicht die Entwicklung einer Theateraufführung. In den vergangenen Jahren haben dabei auch immer breiter gefasste Themen Einzug gehalten, sodass unter dem Begriff nun die gesamte Theatralisierung von Lehr- und Lernprozessen subsummiert werden kann. ‹Drama in education› kann also in unterschiedlichen Fächern als Methode zum Einsatz kommen. Ziel ist aber stets die Bewusstwerdung und Reflexion von (Rollen-)Verhalten in bestimmten Situationen oder hinsichtlich bestimmter gesellschaftlicher Haltungen. Es geht um die Wahrnehmung zwischenmenschlichen Verhaltens und eventuell daraus folgende Verhaltensänderungen. Dabei beschäftigen sich die Teilnehmenden «[…] nicht nur mit dem Inhalt des Geschehens, sondern insbesondere mit körperlichen, gestischen und mimischen Interaktionen und dem emotionalen Verhalten in diesen Situationen. Somit werden Wahrnehmungen und Erfahrungen der beteiligten Subjekte nicht ignoriert, sondern bewusst aktiviert und konkret in den Erkenntnisprozess einbezogen. Über diesen Weg kann gelernt werden, den eigenen Standpunkt zu vertreten oder zu modifizieren und zu verstehen, wie ein soziales Miteinander aussehen und verbessert werden kann.» (Göhmann (2003), S. 81)
Die Problematik von ‹Drama in Education› liegt vermutlich darin, dass allzu deutliche Hinweise auf wünschenswerte Verhaltensänderungen Einzelner oder ganzer Gruppen auch zu Verweigerung und einer ‹jetzt-erst-recht› -Haltung führen und dadurch kontraproduktiv wirken können.
Neben ‹Drama in Education› existieren im englischsprachigen Raum auch noch die Begriffe ‹Theatre education›, was in etwa dem deutschsprachigen ‹Theaterpädagogik› entspricht und als Oberbegriff verstanden werden kann, sowie ‹Theatre in education›, womit Theateraufführungen von Profis im Schulhaus oder Klassenzimmer gemeint sind.
1.7 LAIENSPIEL UND SCHULSPIEL
Als für ein heutiges Verständnis wichtige Quelle der Theaterpädagogik lassen sich auch die Geschichte des Schulspiels und – ausserschulisch und mit dem Laienspiel verbunden – das religiöse Spiel als wesentliche Faktoren für die Entwicklung nennen: Kirchliche Feiern waren und sind oft verbunden mit Schauspielen und ritualisierten Formen von Aufführungen; angefangen bei (Oster-)Prozessionen über ‹Tableaux vivants› und weihnächtliche Stationenspiele bis hin zu Krippenspielen oder der Darstellung religiöser Zusammenhänge und Geschehnisse. Die theatrale Tradition im religiösen Kontext ist lang und oft ein erster Berührungspunkt von Kindern und Jugendlichen mit dem Medium Spiel.
Parallel dazu entwickelte sich seit dem Mittelalter auch ein Schulspiel mit öffentlichen Aufführungen und oft grossen Besetzungen: für Jubiläen und Feiern zeigte die Schule als Gemeinschaftsarbeit Sing- und Festspiele. Bereits 1925 wurden erste Forderungen nach curricularer Verankerung des Darstellenden Spiels als Fach ‹Schulbühne› laut. (Hesse (2008), S. 39)
Das Thema blieb im Gespräch, insbesondere auch im Rahmen der Reformbewegung und der Kunsterziehung. Einen Streitpunkt stellte dabei oft die Diskussion der Frage dar, ob ein eigentliches Fach geschaffen oder das Medium ‹Spiel› in den Kontext der umliegenden Fächer eingebunden werden sollte.
Immer wieder spielte Theater in den schulischen Alltag hinein, blieb aber letztlich doch Spezifikum, Sonderfall und Ausnahme: Theater für besondere Anlässe also, obwohl schon früh unbestritten war, dass gerade das theatrale Spiel zu den menschlichen Urbedürfnissen gehört und auch sein sozialer und kommunikativer Wert nie infrage gestellt wurde.
Dies änderte sich auch in den 1950er-Jahren nicht, als erneut Bestrebungen im Rahmen der musischen Erziehung aufkamen und ein Fach ‹Schulspiel› auch als Chance der ‹Gesittung› und Rückbesinnung zu den alten Grundwerten gefordert wurde. Diese weit gefasste Auslegung des Musischen schloss aus, dass Theater in der Schule bloss ein Fach sein konnte. Theater war Erziehungsprinzip. (Hesse (2008), S. 41)

Grundsätzlich drehte sich die Diskussion immer wieder um die Frage, ob Kunst und künstlerischer Ausdruck instrumentalisiert werden dürften, ob also Theater als Erziehungsmittel, zur Vermittlung von ‹Gesittung› und Werten benutzt (bzw. missbraucht) werden dürfe. Die Diskussion, ob Theaterpädagogik sozialen, pädagogischen und/oder ästhetischen Zielen dienen solle, ist auch heute noch nicht abgeschlossen.
Zur weiteren Vertiefung in das Thema der historischen Entwicklung des Schultheaters sei auf die – mehrheitlich auf Deutschland bezogene – Publikation ‹Zukunft Schultheater – Das Fach Theater in der Bildungsdebatte› (Jurke & Reiss (Hrsg.) (2008)) verwiesen.
Pädagogische Bedeutung
Aktives Theaterspielen hat aus fünf Gründen fundamentale pädagogische Bedeutung:
–Erstens eröffnet das Spiel mit den Fiktionen und den Möglichkeiten auf inszenatorischer, performativer und semiotischer Ebene höchst komplexe Erfahrungs- und Bildungsmöglichkeiten, die nur im Theater und in keiner anderen Kunstform (und schon gar nicht in den Wissenschaften) gewonnen werden können.
–Zweitens eröffnet dieses Spiel auf einer Meta-Ebene Erfahrungen mit dem Bildungsprozess selbst, also die Erfahrung der Möglichkeit von Bildung als Bildung, und das heisst zugleich: der Möglichkeit der Gestaltung von Ich und Welt in ihrer gerade nicht kalkulierbaren, kontingenten und genau dadurch bildenden Wechselwirkung.
–Drittens integriert Theater als «unreine» Kunstform Sprache, Musik, bildende Kunst, Video, Medien, Sport, Tanz etc. Die damit verbundene inhaltliche und kulturelle Komplexität und genuine Interdisziplinarität bietet kein anderes Schulfach.
–Viertens erfordert die Kunstform Theater für ihr Gelingen eine strikte Aufgabenorientierung und damit eine Fülle unterschiedlichster Fähigkeiten und Fertigkeiten, die hier gleichsam nebenbei erworben werden und erworben werden müssen.
–Fünftens eröffnet die Kunstform Theater Erfahrungsmöglichkeiten mit dem Spiel als einer anthropologisch und kulturell fundamentalen Dimension menschlicher Existenz. Damit kommt ihm zentrale Bedeutung für die Bildung insgesamt zu.
Читать дальше