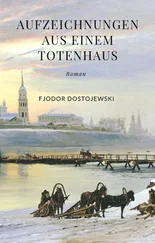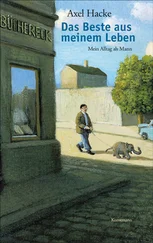In einem Leben voller Menschen besäße ich verschiedenste zarte, wunderschöne Kleidungsstücke, da man allein nach ihnen beurteilt wird und ich ziemlich eitel bin. Aber in meinem Leben gibt es keine Menschen. Das Ganze ist völlig aussichtslos. Ich fühle mich in eine Schraubzwinge eingespannt, die ich mir mit meinen analytischen Folgerungen selbst gemacht habe. Die Freiheit, ein weltliches Leben zu führen, kommt mir nicht zu, bis ich nicht Mich selbst ausgedrückt habe und wenigstens erfahren habe, wo ich stehe, wenn ich schon nicht weiß, wohin ich gehe.
Daher besitze ich Zwei Schlichte Kleider und nichts sonst.
Mehr werde ich vielleicht auch nie mehr brauchen.
Derzeit sind die beiden Kleider aus Serge und Voile. Ich ersetze sie, wenn die Mode sich verändert oder sie abgetragen sind. Sie sind gut geschnitten und passen mir gut. Aber es bleibt bei den beiden und der Schlichtheit. Ich wechsle immer nur von dem einen Kleid zum anderen und vom anderen wieder zu dem einen.
Außerdem habe ich noch ein paar andere Kleidungsstücke. Eine Frau – in welcher Verfassung sie innerlich wie äußerlich auch sein mag – sammelt, was sie nur kann an handgenähter Unterwäsche, anmutigen Nachthemden, Seidenhöschen und allem, was sonst noch so dazugehört. Sie bekleiden eher das Geschlechtswesen als die Person. Die ahnungslose Welt kann sie nicht nach ihnen beurteilen Aber die Frau selbst beurteilt und achtet sich aufgrund der Güte ihrer intimen Kleidungsstücke.
Mein Geschlecht erscheint mir als geheimnisvolles Geschenk. Ich staune es an und umkleide es mit Seide.
Darüber hinaus besitze ich ein oder auch zwei gesund aussehende Hauskleider aus Perkal, in denen ich die Hausarbeit verrichte.
Aber mein dahinschwindendes Leben, mein ängstliches, einsames Leben, wird in den Zwei Kleidern und nichts sonst geführt, und ich brauche nicht mehr.
Morgen
Meine Zwei Kleider führen mir den Spielraum meiner derzeitigen Mary-Mac-Lane-haftigkeit vor Augen.
Jeden Tag sagen sie mir etwas über mich selbst.
Sie sagen mir, dass ich in einem Ich-Gefängnis lebe, unsichtbar, entsagend, düster rechtschaffen.
Sie sagen mir, dass ich äußerlich ein enges Leben führe, grüblerisch und ohne Freunde, und wäre ich aus langer Gewohnheit nicht so selbstgenügsam, würden an einem lepraartigen Aussatz von innen heraus mein Körper und Geist verrotten.
Sie sagen mir, dass aufgrund der äußeren Einsamkeit ein inneres Fieber aus Gefühlen und Ichbezogenheit und ein hitziges analytisches Licht alle Schichten meines Ichs durchdringen: die geistige, körperliche, psychische und die sexuelle.
Sie sagen mir, dass meine Art zu denken grüblerisch und zugleich höhlenweiblich ist.
Sie sagen mir, dass ich von oben bis unten Unverheiratete Jungfer bin und absolut Liebhaberlos.
Sie sagen mir, dass ich einem Kind gleiche und einer unter Vormundschaft gestellten Wilden.
Sie sagen mir, dass mein gesellschaftliches Leben keinerlei behagliche Unwirklichkeiten mit tratschenden Frauen und keine eintönigen, nebenbei blutrünstigen Flirtereien mit Männern enthält.
Sie sagen mir, dass ich jeden Tag an den Rand meines Ichs wandere und in schrecklich süße ichbezogene Abgründe starre.
Sie sagen mir, dass ich Augen wie ein Grab habe und kalt-melancholisch bin.
Sie sagen mir, dass meine Brüste hängen, als hätte man mir etwas geraubt, und meine lose gegürteten Hüften vor Unerfülltheit klappern.
Sie sagen mir, dass ich eine Ödnis bin, was Wahrnehmungen angeht, aber von Gefühlen überschäume.
Sie sagen mir, dass Gott den Zucker weggenommen hat und auch das Schlecken verboten und mir ein paar Kanten Brot und etwas Wasser hingestellt hat.
Morgen
Das Unwichtigste an meinem Leben ist das, was man von ihm greifen kann.
Das Einzige, was auf Dauer zählt, ist, was in mir geschieht.
Wenn ich grausam handele und dabei keine Grausamkeit fühle, bedeutet es nichts für meine Seele. Wenn meine Seele Grausamkeit fühlt, obgleich ich nicht grausam handele, mache ich mich einer Art Gemetzel schuldig und besudele meine geistigen Hände mit Blut.
Meine geistigen Abenteuer sind wirklicher als die äußeren Dinge, die mir zustoßen.
Es befriedigt mich unmittelbar, wenn ich mich mit dem Ich beschäftige, das ich allein kenne – dem Ich, das verschlungen und beweglich ist, getönt, halbgetönt, durchgefärbt, das leuchtet –, ich erlebe ein geistiges Erblühen und mitunter ein wahres Hochgefühl. Das ist nicht immer der Fall, doch es kommt vor.
Immer aber verdüstert es meinen Tag, wenn ich an die Menge der äußeren Ereignisse denke, die mein greifbares Leben ausmachen.
Meine Selbstbeobachtung zieht einen zauberischen Bannkreis um mich, auch wenn er vermutlich schwarz ist.
Aber jede Rückschau wickelt mich in ein Leichentuch.
Wenn der Tag unter tiefhängenden Wolken ohnehin schon dunkel ist – und oft auch, wenn die Sonne hell, hell, hell scheint –, gehe ich in meinem Zimmer auf und ab und denke mit gerunzelter Stirn: plump, heftig und hässlich gerunzelt, über das verstreute Treibgut meines Lebens nach.
Heute war ein bleierner Tag. Die Luft hatte etwas vom höllischen Atem toter Menschen. Ich stützte mich mit den Ellbogen auf mein stumpfes Fensterbrett und schaute hinaus auf grüne und violette Berge. Ich versuchte, einen Grund zu finden – einen greifbaren oder poetischen Grund –, um zu leben.
Ich trug meine lange chinesische Jacke aus Brokat, die auf der linken Seite mit runden blitzenden Glasknöpfen geschlossen wird und mit blauen Fledermäusen und Gardenien bestickt ist, dazu einen plissierten Unterrock aus Seidenkrepp, Seidenschuhe und ansehnliche weiße Seidenstrümpfe. Mir war ganz rechtschaffen zumute, da ich am Vormittag viel Hausarbeit erledigt hatte. Ich hatte gründlich und gut gearbeitet, wobei ich fluchte oder mir Gedichte vorsagte, um in Schwung zu kommen. Danach fühlte ich mich nützlich und gut.
Aber als ich das Spitzenhäubchen, die Schürze und die Häuslichkeit gegen duftende Seide und mein trauriges Fenster eingetauscht hatte, war mir mit einem Mal schwach und verletzlich zumute. Schatten erstürmten meine Mauer, erklommen sie, drangen ein und plünderten mein Schloss. Ich trollte mich von meinem Fenster, kreuzte meine Arme in ihren weiten blauen Ärmeln und wanderte langsam in meinem Zimmer auf und ab. Mir fehlte die innere Kraft, gegen die Schatten anzukämpfen.
Ich zupfte zwei nicht hierhergehörende Fitzelchen, eine Staubfluse und einen Papierschnitzel, vom Teppich, aber in mir nahmen unverdaute und unverdauliche Erinnerungen ihren Lauf.
Sie eröffneten einen unbefriedigenden und unzufrieden machenden Blick auf eine Reihe von Mary MacLanes.
Da war der dickköpfige Säugling in Winnipeg-Kanada, ein Baby mit, wie man mir sagt, weicher Haut, kalten nachdenklichen dunkelblauen Augen, ohne Haar, ohne Stimme, in handgenähten Kleidchen aus Musselin, Gesichtsausdruck fett und plump.
Die Mary MacLane, die ich heute bin.
Da war das dreijährige Kind, an das ich mich dunkel erinnere, immer noch in Kanada, immer noch dickköpfig, mit einem kräftigen, fassartigen, rosaweißen Körper, erstaunlichen blauen Augen, einer mickrigen Stimme, dicken sonnenfarbenen Locken, Batistkleidchen, kurzen weißen Socken und mürrischem Naturell. Es gab etwas, das sie liebte: ein gelbes Schildpattkätzchen, das sie umarmte und gewaltsam umarmte, bis es eines Tages überraschenderweise in ihren Armen verstarb.
Die Mary MacLane, die ich heute bin.
Da war das sieben Jahre alte Kind in Minnesota, an das ich mich gut erinnere, noch immer dickköpfig, noch immer häufig mürrisch, mit einem dünnen, knochigen Körper, wissenden grauen Augen, einem gebräunten Gesicht, wettergegerbten Händen, unordentlichen Kleidern, schönem flaumigem goldenem Haar, einer Neigung zu Heimlichkeit und Lügen, einem grüblerischen Geist, phantastischen Tagträumen und der freien Lebensweise eines Wildfangs. Sie hatte Spielkameraden, aber keine besondere Zuneigung außer einer vorurteilslosen Vorliebe für stille, grüne Wälder, süße Wiesen, windige Hügel, strohgefüllte Scheunen und sämtliche Einzelheiten an der Oberfläche des Lebens. Durchaus eigen war ihre Abscheu gegen jede Art von Getue, das um sie gemacht wurde, gegen Neckereien und Verwandte.
Читать дальше