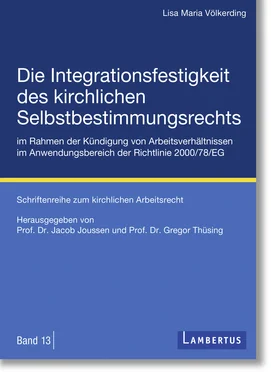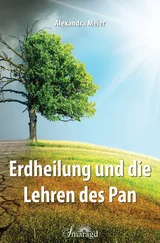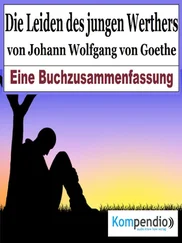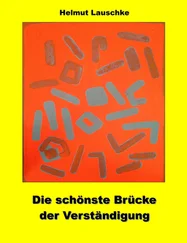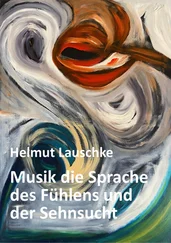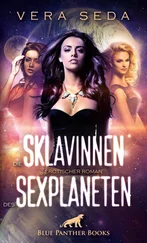3. Zusammenfassung und Stellungnahme
IV. Die Leitentscheidungen des BVerfG zur Reichweite des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts im Rahmen der Kündigung von Arbeitsverhältnissen
1. Rechtliche Situation bis 1985
2. Die Stern-Entscheidung des BVerfG
a) Hintergrund
b) Die Gründe des Stern-Urteils
3. Die Chefarzt-Entscheidung
a) Hintergrund
b) Die Gründe des Chefarzt-Urteils
4. Zusammenfassung und Stellungnahme
§ 3 Anerkennung und Einschränkung des Selbstbestimmungsrechts kirchlicher Arbeitgeber durch Rechtssetzung und Rechtsprechung der EU
A. Das Religionsverfassungsrecht als Kompetenzgrenze der EU
B. Normative Verankerung des Selbstbestimmungsrechts kirchlicher Arbeitgeber in der Unionsrechtsordnung
I. Achtung der nationalen Identität der Mitgliedstaaten (Art. 4 Abs. 2 S. 1 EUV)
II. Unionsrechtlicher Grundrechtsschutz
1. Art. 9 EMRK (i.V.m. Art. 11 EMRK)
a) Individuelle und korporative Religionsfreiheit
b) Selbstbestimmungsrecht kirchlicher Arbeitgeber im Rahmen der Kündigung von Arbeitsverhältnissen
aa) Problematik der Bestimmung eines europäischen Mindeststandards
bb) Schutzbereichsdefinition im Lichte der Rechtsprechung des EGMR
(1) Transzendenzschutz nach Obst, Schüth und Siebenhaar?
(2) Tendenzschutz nach Fernández Martínez?
(3) Tendenzschutz nach Travas?
cc) Zwischenergebnis
2. EU-GRCh
III. Die Erklärung Nr. 11 der Schlussakte zum Vertrag von Amsterdam
IV. Art. 17 AEUV
1. Abwägungslösung
2. „Öffnungslösung“
3. Eigener Standpunkt
V. Art. 167 AEUV
VI. Ergebnis
C. Grundlagen des europäischen Antidiskriminierungsrechts
I. Primärrechtliche Grundlagen
1. Zentrale Antidiskriminierungsnormen im Vertragsrecht der Union
2. Diskriminierungsverbote in der EU-GRCh
3. Das Diskriminierungsverbot als allgemeiner unionsrechtliche Grundsatz
II. Die RL 2000/78/EG
1. Geltungsbereich
2. Die Diskriminierungsmerkmale „Religion“ und „Weltanschauung“
3. Die Ausnahmeregelungen des Art. 4 Abs. 2 RL 2000/78/EG für kirchliche Arbeitgeber
a) Genese
b) Verhältnis zu Art. 4 Abs. 1 RL 2000/78/EG
c) Persönlicher Anwendungsbereich
(aa) Grundsätzliches
(bb) Subjektive Schutzberechtigung von juristischen Personen des Privatrechts
(cc) Überprüfbarkeit des Ethos öffentlicher und privater Organisationen
d) Sachlicher Anwendungsbereich
(aa) Erfasste berufliche Tätigkeiten
(bb) Anwendbarkeit auf kirchliche Bildungsverhältnisse
(cc) Anwendbarkeit auf selbstständig Beschäftigte
(dd) Statische Gepflogenheit, dynamische Normierung
D. Die Auslegung der Ausnahmevorschrift des Art. 4 Abs. 2 RL 2000/78/EG durch den EuGH
I. Art. 4 Abs. 2 Unterabs. 1 RL 2000/78/EG nach der Egenberger-Entscheidung
1. Hintergrund der EuGH-Entscheidung Egenberger
2. Auslegung der Tatbestandsmerkmale durch den EuGH in Sachen Egenberger
a) Entscheidungskompetenz hinsichtlich des Vorliegens der Tatbestandsvoraussetzungen „angesichts des Ethos“
b) Einschränkung des Selbstbestimmungsrechts durch Art und Umstände der Tätigkeit
c) Gewichtung des Kriteriums „wesentliche“
d) Differenzierung zwischen einer „rechtmäßigen“ und einer „gerechtfertigten“ Anforderung
e) Verhältnismäßigkeitsgrundsatz
II. Art. 4 Abs. 2 Unterabs. 2 RL 2000/78/EG nach der IR-Entscheidung
1. Hintergrund der EuGH-Entscheidung IR
2. Auslegung der Tatbestandsmerkmale durch den EuGH in Sachen IR
III. Kritische Würdigung der Argumentation des EuGH
1. Substanzlose Tatbestandsdefinitionen
2. Fehlerhafte Deutung der Bezugnahme in Erwägungsgrund Nr. 24
3. Verkennung des Willens des Richtliniengebers
4. Verkennung der Normhierarchie des Unionsrechts
IV. Primärrechtskonformität der Urteile Egenberger und IR
1. Möglicher Verstoß gegen das Achtungsgebot des Art. 17 Abs. 1, Abs. 2 AEUV
2. Möglicher Verstoß gegen das Beeinträchtigungsverbot des Art. 17 Abs. 1, Abs. 2 AEUV
3. Vorläufiges Ergebnis
V. Vorschlag einer primärrechtskonformen Auslegung des Art. 4 Abs. 2 RL 2000/78/EG
1. Die primärrechtskonforme Auslegung von sekundärem Unionsrecht
2. Prinzipielle Öffnung der Richtliniennorm zugunsten eines nationalen Ausgleichs
a) Wortlaut
b) Systematik
c) Regelungszweck
d) Zwischenergebnis
3. Öffnung der EuGH-Rechtsprechung zugunsten eines nationalstaatlichen Ausgleichs
a) Anknüpfungspunkt: Art und Umstände der Tätigkeit
b) Anknüpfungspunkt: Die Auslegung des Merkmals „gerechtfertigte“
(aa) Problemaufriss
(bb) Eigener Standpunkt
(cc) Vorschlag einer primärrechtskonformen Durchführung der arbeitsgerichtlichen Kontrolle des kirchlichen Vortrags
(dd) Zwischenergebnis
c) Anknüpfungspunkt: Die Auslegung des Merkmals „wesentliche“
d) Anknüpfungspunkt: Die Auslegung des Merkmals „rechtmäßige“
e) Anknüpfungspunkt: Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz
4. Ergebnis
E. Die Umsetzungsnorm des § 9 AGG als Ausgangspunkt eines Mehrebenenkonflikts
I. Die Ausnahmeklausel des Art. 9 Abs. 1 AGG
1. Persönlicher Anwendungsbereich
a) Zugeordnete Einrichtungen
b) Vereinigungen, die sich die gemeinschaftliche Pflege einer Religion oder Weltanschauung zur Aufgabe machen
2. Sachlicher Anwendungsbereich
3. Auslegung der Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 AGG durch das BAG
a) § 9 Abs. 1 Hs. 1 AGG: „[…] unter Beachtung des Selbstverständnisses der jeweiligen Religionsgemeinschaft oder Vereinigung im Hinblick auf ihr Selbstbestimmungsrecht […]“
(aa) Genese
(bb) Stand der Diskussion bis zum Urteil des BAG vom 25. Oktober 2018
(cc) Das Egenberger-Urteil des BAG
b) § 9 Abs. 1 Hs. 2 AGG: „[…] oder nach der Art der Tätigkeit […]“
c) § 9 Abs. 1 Hs. 2 AGG: „[…] eine gerechtfertigte berufliche Anforderung darstellt.“
d) Ergebnis
II. Die Ausnahmeklausel des Art. 9 Abs. 2 AGG
1. Personeller und sachlicher Anwendungsbereich
2. Auslegung der Voraussetzungen des § 9 Abs. 2 AGG durch das BAG
a) Stand der Diskussion bis zum Urteil des BAG vom 20. Februar 2019
b) Das zweite Chefarzt-Urteil des BAG
c) Ergebnis
III. Das Verhältnis der BAG-Entscheidungen zur „Zwei-Stufen“-Prüfung des BVerfG
1. §§ 1, 7 i.V.m. § 9 Abs. 1 AGG
a) Widerspruch zur Plausibilitätskontrolle des BVerfG
b) Widerspruch zur Interessenabwägung des BVerfG?
c) Zwischenergebnis
2. §§ 1, 7 i.V.m. § 9 Abs. 2 AGG
3. Ergebnis
IV. Ungenutzte Öffnungsklauseln
1. Rechtssache Egenberger
2. Rechtssache IR
3. Ergebnis
V. Die richtlinienkonforme Auslegung des § 9 AGG
1. Zur Methode der richtlinienkonformen Auslegung
2. § 9 Abs. 1 Hs. 1 AGG: „[…] unter Beachtung des Selbstverständnisses der jeweiligen Religionsgemeinschaft oder Vereinigung im Hinblick auf ihr Selbstbestimmungsrecht […]“
a) Grenzen der richtlinienkonformen Auslegung
aa) Wortlaut
bb) Wille des historischen Gesetzgebers
cc) Gesetzgebungsgeschichte
dd) Ergebnis
b) Folge der Begrenzung richtlinienkonformer Auslegungsmöglichkeiten
aa) Vereinbarkeit mit dem EU-Primärrecht
bb) Vereinbarkeit mit den verfassungsrechtlichen Vorgaben
3. § 9 Abs. 1 Hs. 2 AGG: „[…] oder nach der Art der Tätigkeit […]“
a) Begrenzung der unionskonformen Auslegung durch den gesetzgeberischen Willen
b) Richtlinienkonforme Auslegung der Tatbestandsmerkmale
c) Vereinbarkeit mit den verfassungsrechtlichen Vorgaben
Читать дальше