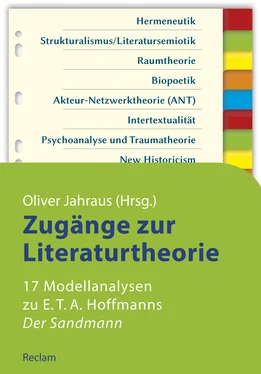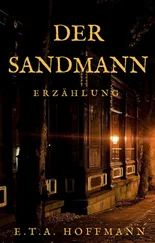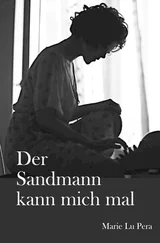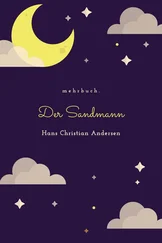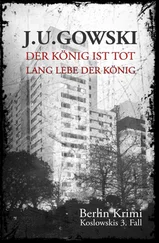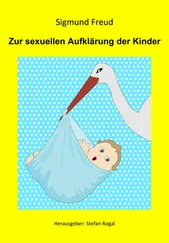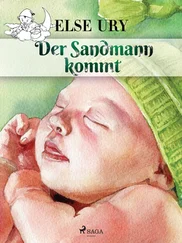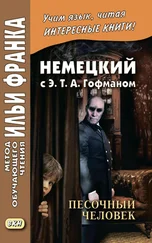Erneut ist es also das Fernglas Coppolas, das eine deviante, jetzt manifest pathologische Wahrnehmung und Handlung in Gang setzt. Die Erinnerung an die verzerrte Perspektive des Fernglases aktiviert die substantielle Verzerrung der Psyche (Freud 2010, 199). Nur dem beherzten Eingreifen Lothars ist es zu verdanken, dass Clara gerettet wird und Nathanael sich durch einen Sprung in den Tod seiner Qualen entledigt. Ohne Zweifel hat nicht nur Clara, sondern haben auch ihr Bruder und Nathanaels Mutter die Zeichen der nur scheinbaren Heilung des gefährlich Kranken verkannt. Erkennbar inszeniert Hoffmann dieses Unverständnis als Produkt ihrer Sehnsüchte nach der Gesundheit des von ihnen geliebten Sohnes, Mannes und Bruders. Dabei wird nicht das Scheitern der Aufklärung schlechthin inszeniert, sondern die Grenzen des Verständnisses für das pathologisch Andere der Vernunft, das sich allerdings des Scheins der Vernünftigkeit bedienen kann, und deren (lebensbedrohliche) Gefahren für die Missverstehenden.
Dieses semantische und systematische Allgemeine zeigt Hoffmann auch an zwei auffälligen und häufig interpretierten einzelnen Motiven: Im Rahmen des Streites zwischen Spalanzani und Coppola, den Nathanael beobachtet, nennt Spalanzani den Konkurrenten doch tatsächlich »Coppelius« (32/[37]), und schon vorher meint der hinzukommende Nathanael, »des […] Coppelius Stimme« vernommen zu haben. Damit würden die zu Beginn brieflich geäußerten Ängste des Traumatisierten Bestätigung finden.
Spalanzani wechselt aber auch wieder zum Gebrauch des Namens Coppola zurück, so dass der Leser nicht vollends entscheiden kann, ob der zutiefst aufgewühlte Nathanael diesen gefürchteten Namen bloß zu hören meinte oder ob der Erzähler ihn tatsächlich selbst verwendet hat: Es bleibt bis zum Schluss der Erzählung ungeklärt, ob die beiden Namen eine oder zwei Personen bezeichnen, so dass auf der Ebene der gesamten Erzählung die angstbesetzte Unsicherheit des Protagonisten reproduziert wird. Die Logik der kranken Seele produziert eben keine semantische Nichtigkeit, also Unsinn, sondern durchaus wahrscheinliche Annahmen, die die Gefahren, die in ihr schlummern, allererst sichtbar werden lassen. Nathanaels Angst vor dem alchemistischen Kinderquäler bleibt bis zum Schluss legitim und daher seine Befürchtung in Bezug auf die prägende Rolle dieser Figur für sein Verhängnis zumindest nachvollziehbar. Es geht Hoffmann also anscheinend nicht um die Objektivität des Glaubens an böse Mächte, es geht ihm um die Gründe für die subjektive Überzeugungskraft solcher Annahmen. Und für diese Absicht – und nicht um sich einem Verständnis abstrakt zu entziehen – wird die Unsicherheit des Protagonisten auf der Ebene der Erzählung wiederholt.
Ähnliches gilt für das zentrale Motiv der Augen, das in unterschiedlichen Varianten und Bedeutungen die Erzählung prägt.11 Als zentrales Organ der Licht in die Welt bringenden Aufklärung ist das Auge von Beginn an für Nathanael gefährdet, insbesondere in der Szene der Entdeckung während des alchemistischen Versuches, in der der Vater seinen Sohn scheinbar vor der Blendung durch Coppelius rettet. Als ›Spiegel der Seele‹, in dem sich beispielsweise die untadelige moralische Gesinnung Claras dokumentiert, ist dieses Organ zugleich das am schwierigsten technisch zu reproduzierende, weshalb Spalanzani auf die Künste Coppolas angewiesen ist und bleibt. Nur durch die Verzerrungen des Ferne nahbringenden Perspektivs zeigen sich für den liebestollen Nathanael die Leidenschaften der toten Puppe Olimpia. In den verschiedenen Formen und Funktionen der Augen spiegelt sich damit letztlich das zentrale Thema der Unvermittelbarkeit von Glauben und Wissen. Denn nur von der augen- und seelenlosen Olimpia fühlt sich der Romantiker Nathanael »ganz verstanden« (31/[36]).
Die vorstehende Interpretation hat versucht, aus den spezifisch literarischen Elementen und Momenten der Hoffmann’schen Erzählung wie u. a. der Gattungsmischung, der Figurenkonstellation und des Plots eine Deutung des impliziten Bedeutungsganzen zu ermitteln. Durch eine dem Text angemessene Kombination des Verstehens offensichtlicher und des Interpretierens zunächst undeutlicher Passagen und Elemente wurde versucht, eine dem Text innewohnende Bedeutungskohärenz zu rekonstruieren. Durch die Berücksichtigung eines spezifischen historischen Kontextes, nämlich des umstrittenen Verhältnisses von Glauben und Wissen, wurde es möglich, den Grund für das von Hoffmann bewusst hergestellte Unbestimmbare, Geheimnisvolle zu ermitteln: Hoffmann gestaltet dieses Thema als einen unlösbaren, tödlichen Konflikt, der auf den Gefahren beider ins Extrem getriebenen Positionen, der Aufklärung wie der Romantik, basiert.
Als ein allgemeines Verfahren zur Behandlung von literarischen Texten ist diese Art von analytischer und kontextualisierender Hermeneutik jeder Methodik zugrunde zu legen.
Anton, Anette C.: Authentizität als Fiktion. Briefkultur im 18. und 19. Jahrhundert. Stuttgart/Weimar 1995.
Drux, Rudolf: Nachwort. In: E. T. A. Hoffmann: Der Sandmann. Hrsg. von R. D. Stuttgart 2014. S. 61–77.
Freud, Sigmund: Das Unheimliche (1919). In: S. F.: »Der Dichter und das Phantasieren«. Schriften zur Kunst und Literatur. Hrsg. von Oliver Jahraus. Stuttgart 2010. S. 187–227.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Glauben und Wissen oder Reflexionsphilosophie der Subjektivität in der Vollständigkeit ihrer Formen als Kantische, Jacobische und Fichtesche Philosophie. In: G. W. F. H.: Werke in 20 Bänden. Hrsg. von Eva Moldenhauer / Karl Markus Michel. Bd. 2. Frankfurt a. M. 1986. S. 287–433.
Hilpert, Daniel: magnetisches Erzählen. E. T. A. Hoffmanns Poetisierung des Mesmerierens. Freiburg 2013. S. 156–195.
Kablitz, Andreas: Kunst des Möglichen. Theorie der Literatur. Freiburg 2013.
Miller, Norbert: Der empfindsame Erzähler. Untersuchungen an Romananfängen des 18. Jahrhunderts. München 1968.
Mülder-Bach, Inka: Das Grau(en) der Prosa oder: Hoffmanns Aufklärungen. Zur Chronik des Sandmann. In: ›Hoffmanneske Geschichten‹. Zu einer Literaturwissenschaft als Kulturwissenschaft. Hrsg. von Gerhard Neumann. Würzburg 2005. S. 199–221.
Neumann, Gerhard: E. T. A. Hoffmann: Der Sandmann. In: Meisterwerke der Literatur. Von Homer bis Musil. Hrsg. von Reinhard Brandt. Leipzig 2001. S. 185–216.
Neymeyr, Barbara: Narzißtische Destruktion. Zum Stellenwert von Realitätsverlust und Selbstentfremdung in E. T. A. Hoffmanns Nachtstück »Der Sandmann«. In: Poetica 29 (1997) S. 499–531.
Picard, Hans Rudolf: Die Illusion der Wirklichkeit im Briefroman des 18. Jahrhunderts. Heidelberg 1971.
Reuchlein, Georg: Bürgerliche Gesellschaft, Psychiatrie und Literatur. Zur Entwicklung der Wahnsinnsthematik in der deutschen Literatur des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts. München 1986.
Saße, Günter: Der Sandmann. Kommunikative Isolation und narzisstische Selbstverfallenheit. In: G. S.: E. T. A. Hoffmann. Romane und Erzählungen. Stuttgart 2004. S. 96–116.
Reil, Johann Christian: Rhapsodieen über die Anwendung der psychischen Kurmethode auf Geisteszerrüttungen. Halle 1803.
Schmidt, Jochen: Die Krise der romantischen Subjektivität: E. T. A. Hoffmanns Künstlernovelle »Der Sandmann« in historischer Perspektive. In: Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. FS für Richard Brinkmann. Hrsg. von Jürgen Brummack [u. a.]: Tübingen 1981. S. 348–370.
Schubert, Gotthilf Heinrich: Die Symbolik des Traumes. Faksimiledruck nach der Ausgabe von 1814. Mit einem Nachwort von Gerhard Sauder. Heidelberg 1968.
Tepe, Peter / Jürgen Rauter / Tanja Semlow: Interpretationskonflikte am Beispiel E. T. A. Hoffmanns »Der Sandmann«. Würzburg 2009.
Weimar, Klaus: Was ist Interpretation? In: Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes 2 (2002) S. 104–115.
Читать дальше