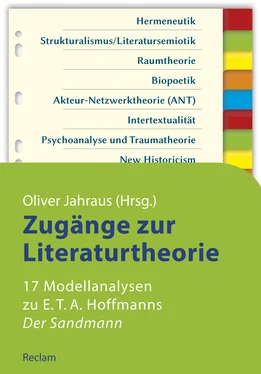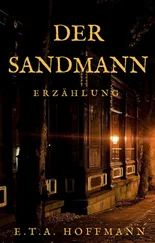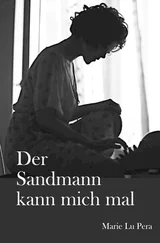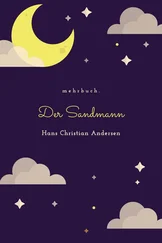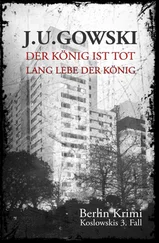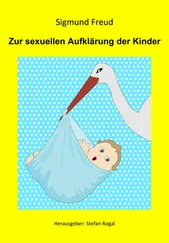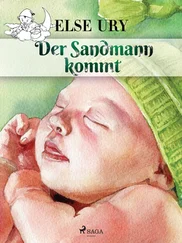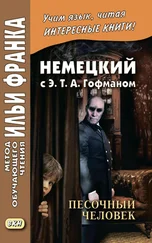Neuere Forschung zur literarischen Hermeneutik, die eine enge Verbindung zwischen den Verfahren des Interpretierens und einer allgemeinen Literaturtheorie herstellt, konnte allerdings zeigen (Kablitz 2013, 149 ff.), dass jeder literarische Text, auch jener mit scheinbaren semantischen Leerstellen, zu einer impliziten Kohärenzbildung tendiert, die eine jede Interpretation zu rekonstruieren hat und dies auch kann. Implizite Kohärenzbildung bedeutet in diesem Zusammenhang, dass jeder literarische Text eine semantische Einheit ausbildet, die im Prozess der Interpretation herauszuarbeiten bzw. zu explizieren ist. Unklaren Stellen kommen in diesem Kontext bestimmbare Funktionen zu, weil »die Annahme impliziter Kohärenzbildung als strukturbildendem Merkmal poetischer Rede […] so etwas wie eine regulative Idee im Umgang mit Literatur« bildet (ebd., 199). Literarische Texte bilden also mit Notwendigkeit in sich differenzierte semantische Einheiten aus, die der Interpret explizieren kann und muss, weil die Hermeneutik nicht nur von einer grundsätzlichen Möglichkeit der Interpretation des literarischen Textes ausgeht, sondern davon, dass der Text einer Interpretation bedarf, also die Notwendigkeit einer Interpretation behauptet. Tatsächlich lässt sich an der Textgenese des Sandmanns nachweisen, dass Hoffmann bestimmte Handlungselemente noch für die Druckfassung bewusst verunklarte. Nicht zuletzt aus diesem Grunde hat das Problem der Uneindeutigkeit als konstitutives Moment eines kohärenten Sinns der Erzählung zu gelten.
Obwohl zumindest ein Zielpunkt, bilden den Ausgangspunkt einer jeden Interpretation literarischer Texte dennoch keineswegs die unmittelbaren oder mittelbaren Unklarheiten. Vielmehr kann sie von den formalen und inhaltlichen Eigentümlichkeiten des Textes ausgehen, die problemlos erkennbar sind, und im Prozess ihrer allmählichen begrifflichen Erfassung deren spezifisch poetische Vermittlung bestimmen. Interpretationen versuchen also, die einzelnen Teile des Textes, deren Verhältnis zueinander und bei der Vermittlung zum gehaltlichen Ganzen zu bestimmen. Das Ziel solcher Deutung besteht in der Bestimmung jenes allgemeinen Aussagegehaltes, den Literatur – anders als die das empirisch Besondere rekonstruierende Geschichtsschreibung – gestaltet. Dabei kann sich der Interpret durchaus unterschiedlicher Methoden bedienen.
II Zwischen brieflicher Narration und heterodiegetischem Erzähler
Eine der auffälligsten formalen Besonderheiten des Sandmanns besteht in seiner Kombination unterschiedlicher Erzählformen. Der Text beginnt – ohne jede Vorrede – mit der Präsentation dreier Briefe, die die Vorgeschichte sowie die Exposition der nachfolgenden Handlung darlegen. Hoffmann bedient sich mit diesem Beginn der seit Richardsons Clarissa , Rousseaus Nouvelle Héloїse und Goethes Werther europaweit ebenso beliebten wie produktiven Brieferzählung bzw. des Briefromans, der die Handlung aus der Sicht einer oder mehrerer Briefschreiber entfaltet. Der ästhetische Vorzug und Grund der Beliebtheit dieser Erzählform besteht in der erlebten Nähe zu den Figuren, weil sich im Brief nicht nur die sprachlich-reflektierte Subjektivität, sondern auch die emotive Individualität des Schreibers direkt umsetzen lässt. Mit dem Beginn einer Briefreihe befindet sich der Leser mitten im Bewusstsein, medium in personam der Protagonisten einer Erzählung (vgl. Miller 1968, 135–214), und so auch bei Hoffmann: Der erste Brief der Erzählung stammt von Nathanael, der zentralen Figur des Sandmanns , der nicht nur den Grund seines Schreibens mit dem Eintreten eines »Entsetzliche[n] […] in mein Leben« (9/[3]) angibt, sondern auch die hierfür konstitutive Vorgeschichte aufgewühlt schildert.
Dabei enthält dieser Brief nicht nur die entscheidenden Informationen über Vergangenheit und Gegenwart des Schreibers; er liefert zugleich ein Charakterbild Nathanaels durch die Rhetorik seiner Sprachfügungen und den Stil seines brieflichen Schreibens. So präsentiert sich dem Leser ein durch den gewaltsamen Tod des Vaters und dessen für den Briefschreiber nicht vollends durchsichtige Vor- und Verursachungsgeschichte schwer traumatisierter junger Mann, der davon überzeugt ist, dass »ein dunkles Verhängnis wirklich einen trüben Wolkenschleier über mein Leben gehängt hat« (14/[10]).
Den Grund für diese Überzeugung entfaltet der Briefschreiber selbst durch den Bericht seiner Kindheitsgeschichte, die zum einen geprägt wurde durch liebevolle harmonische Familiarität, die aber zum anderen durchbrochen wurde durch des Vaters Leidenschaft für Alchemie. Deren heimliche Ausübungen unter der Ägide eines »Meisters« machten viele Familienabende zu bedrückenden Ereignissen. Nicht nur erweist sich dieser Alchemist, dem sich der Vater bedingungslos unterwirft, lange Zeit als unerkannte Figur, die durch unbedachte Erzählungen der Mutter und der Amme vom Kind mit einem »Sandmann« identifiziert wird, der Kindern die Augen stiehlt, um seine Jungen zu ernähren. Auch erweist sich der tatsächliche Alchemist nicht als Sandmann, sondern als herrschsüchtiger Kinderquäler. Als Nathanael, seinen Ängsten und seiner Neugier nachgehend, die alchemistischen Versuche der beiden Männer heimlich beobachtet, wird er entdeckt und vom Coppelius, so der Name des Alchemisten, derart misshandelt, dass er in ein wochenlanges Fieber verfällt. Nathanael beendet seinen Bericht mit der Schilderung des durch einen misslungenen alchemistischen Versuch bewirkten Todes des Vaters, der die Familie endgültig zerstört, während »Meister« Coppelius sich seiner nachweislichen Schuld durch Flucht entzieht.
All dies kommt dem Studenten Nathanael wieder ins Bewusstsein, weil er glaubt, jenem Coppelius in der Gestalt des Wetterglashändlers Coppola in seiner Universitätsstadt erneut begegnet zu sein: Dies erklärt seinen aufgewühlten Zustand und motiviert das Schreiben des Briefes, in dem er diesen Zustand wiederzugeben versucht.
Nathanael erweist sich in diesem Brief als ein sprachlich eloquenter Jüngling, der an die Existenz Böses bewirkender, metaphysischer Kräfte glaubt, denen er sich rettungslos ausgeliefert sieht. Gleichwohl – und das macht einen entscheidenden Grund für den hochemotionalen Zustand des Briefschreibers aus – sieht er die Gelegenheit gekommen, »des Vaters Tod zu rächen« (15/[12]).
Auch der zweite Brief leistet diese zweifache Darstellungsdimension: Er stammt von Clara, der Verlobten, die auf den Brief Nathanaels zu antworten sucht. Diese Antwort ist ihr aber nur deshalb möglich, weil der Brief ihres geliebten Nathanael – obwohl für ihren Bruder verfasst – vom Schreiber irrtümlicherweise an sie adressiert wurde. Clara nutzt die Gelegenheit, um in einem ebenfalls persönlichen und emotionalen Brief ihren Verlobten davon zu überzeugen, dass jene metaphysischen Mächte, an die er glaubt und von denen er sich beherrscht sieht, lediglich innerpsychische Wirkmächte seien. Nathanaels Glauben an die Objektivität des Wunderbaren, also metaphysischer Mächte, die den Gesetzen der Natur und der Vernunft widersprechen, weil sie sie übersteigen, setzt Clara das Wissen um die Subjektivität jener Erscheinungen entgegen, deren innerpsychische Realität sie keineswegs bestreitet:
»Gerade heraus will ich es dir nur gestehen, dass, wie ich meine, alles Entsetzliche und Schreckliche, wovon du sprichst, nur in deinem Innern vorging, die wahre wirkliche Außenwelt aber daran wohl wenig teilhatte.« (16/[13])
Doch Clara geht in ihrem Brief noch weiter: Sie erklärt ihrem Verlobten nicht nur die allzu wahrscheinlichen Gründe für das Auftreten seiner Glaubensüberzeugungen: die unglückliche Kombination von »Ammenmärchen« über den Sandmann, »dem alten Coppelius« und dem »unheimliche[n] Treiben mit deinem Vater« sowie dessen »trügerische[m] Drange nach hoher Weisheit«, durch den »viel Geld unnütz verschleudert« wurde (16/[13 f.]). Clara liefert mithin so etwas wie eine spätestens seit David Hume (1711–1776) in Europa diskutierte Psychopathologie des religiösen Glaubens.
Читать дальше