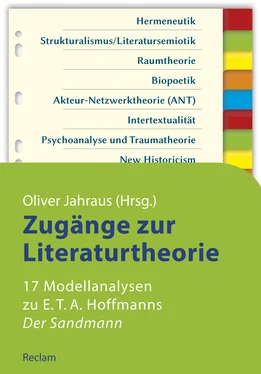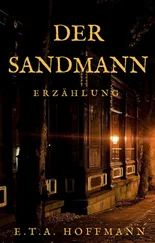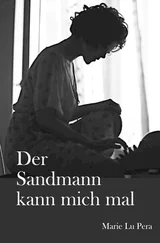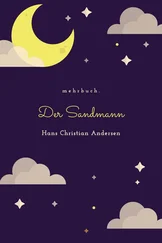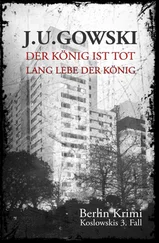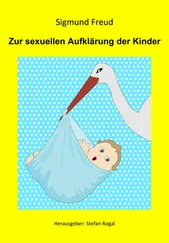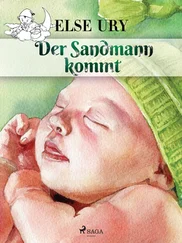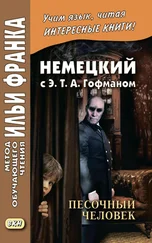Diese nimmt im Zuge der fortschreitenden Verfestigung der Liebesbeziehung stets konkretere Formen an: Zunächst kommt es zu einer ersten, allerdings gleich stürmischen Begegnung im Rahmen eines großen Festes, eines »Konzert[s] und Ball[s]« (27/[30]), das Spalanzani für die Universitätsgesellschaft ausrichtet und auf dem er seine Tochter, die er bis dato nur im Hause hielt, der Öffentlichkeit zu präsentieren gedenkt. Tatsächlich kommt es zu diesem Auftritt und einer Begegnung zwischen dem Studenten und der Professorentochter, allerdings erst, nachdem Nathanael – als Student in die hinteren Reihen verbannt – den ›Gegenstand‹ seiner Begierde durch das Fernglas betrachtet:
»Ganz unvermerkt nahm er deshalb Coppolas Glas hervor und schaute hin nach der schönen Olimpia. Ach! – da wurde er gewahr, wie sie voll Sehnsucht nach ihm herübersah, wie jeder Ton erst deutlich aufging in dem Liebesblick, der zündend sein Inneres durchdrang.« (28/[31])
Erst die schon gleichsam internalisierte Ersatzhandlung des Fernglasblickes auf dem Fest garantiert dem liebestollen Nathanael, dass seine Gefühle erwidert werden. Die verfremdende Perspektive der nahen Ferne ist nicht allein deshalb erforderlich, um die Umgebung auszublenden, sondern auch, um den narzisstischen Projektionsprozess glücken zu lassen. Ohne Coppolas ›Perspektiv‹ hätte sich Nathanael niemals verliebt bzw. dieser Liebe nachgeben können.
Gleichwohl ermöglicht ihm diese Perspektive, einen Schritt auf das geliebte Wesen zu zu machen. Nach Beendigung des Konzerts und Beginn des Balls kann der Protagonist die Professorentochter zum Tanz auffordern und erlebt – ohne dies zu verstehen – nach dem optischen einen zugreifenden, haptischen Projektionsprozess, indem er nicht mehr die Augen mit Liebe, sondern die tote Hand mit Wärme überzieht:
»Eiskalt war Olimpias Hand, er fühlte sich durchbebt von grausigem Todesfrost, er starrte Olimpia ins Auge, das strahlte ihm voll Liebe und Sehnsucht entgegen und in dem Augenblick war es auch, als fingen an in der kalten Hand Pulse zu schlagen und des Lebensblutes Ströme zu glühen.« (28/[31])
Nie zuvor hatte Nathanael solche »Liebeslust« empfunden, und zwar gerade deshalb, weil Olimpia kaum Worte verliert und so zu der widerstandslosen Projektionsfläche wird, die die bedingungslose romantische Liebe erwartet und erfordert. So wie Olimpia schweigen muss, kann Nathanael der Verbalisierung seiner Liebe uneingeschränkt nachgehen; ist Olimipa des Sprechens kaum mächtig, so Nathanael in einer Weise, die jedes Verständnis von sich weist: »Er saß neben Olimpia, ihre Hand in der seinigen und sprach hoch entflammt und begeistert von seiner Liebe in Worten, die keiner verstand, weder er, noch Olimpia.« (29/[32]) Auf dem Weg in den »Wahnsinn«, mithin in die schwere psychische Erkrankung, mit der die romantische Liebe hier identifiziert wird, wird das Sprechen des zunehmend Erkrankenden unverständlicher.
Gleichwohl und trotz des vernehmbaren Spotts anderer Ballteilnehmer über Nathanaels Leidenschaft für eine nahezu sprach- und scheinbar empfindungslose junge Frau nimmt das Verhältnis zwischen Nathanael und Olimpia in der Folge die konkretere Form regelmäßiger, ja täglicher Treffen an, auf denen der junge Mann seiner Geliebten stundenlang aus seinen Papieren vorliest. Die so Angebetete kann dem mit nie enden wollender Geduld zuhören.
Wichtig ist in diesem Stadium der Erzählung, dass die Öffentlichkeit einschließlich seiner Studienfreunde Nathanaels Leidenschaft für die Professorentochter ob deren »Stumpfsinn« (30/[33]) zwar für eigentümlich oder gar deviant (also für nur besonders schwer abweichend vom üblichen Standard), keineswegs aber für pathologisch (also für seelisch krank) hält, weil tatsächlich niemand in dieser Figur eine Puppe bzw. einen Automaten erkennt. Als scheinbar echter Mensch, als Frau aus Fleisch und Blut, erscheint sie nicht nur dem liebestollen Nathanael, sondern auch »der Gesellschaft«, die sich erst später für diesen Betrug an Spalanzani zu rächen weiß. Nur deshalb, weil die beiden Automaten-Ingenieure gute Arbeit geleistet hatten, kann die Katastrophe in Gang gesetzt werden. Natürlich leistet sich Hoffmann mit dieser Konstellation auch eine Kritik am zeitgenössischen (allerdings bröckelnden) Frauenideal, das in der intellektuellen Passivität und körperlichen Makellosigkeit seine wesentlichen Elemente hatte: Nicht allein Nathanael sitzt seinen Vorurteilen und seinen Bedürfnissen auf. Auf dieser Ebene ist der psychisch Erkrankende nur die Allegorie einer in ihre Konventionen verstrickten Gesellschaft (vgl. auch Hilpert 2013).
Zugleich besteht eine entscheidende Voraussetzung für diese Art des Missbrauchs von Vorurteilen zu experimentellen Zwecken in der herausragenden technischen Leistung Spalanzanis und Coppolas, die dem Automaten Olimpia zu einem überzeugenden Anschein von Leben verhelfen. Hatte Nathanael Clara als »lebloses […] Automat« (24/[25]) beschimpft, weil sie seinem Glauben an das radikale Böse als metaphysische Macht kein Verständnis entgegenbringen konnte und wollte, so schenkt er der Lebendigkeit des tatsächlichen Automaten Olimpia deshalb Glauben, weil dieser seine Bedürfnisse nach Projektion bedingungslos erfüllt.
Dieser vom Experimentator Spalanzani beförderte Prozess der Verbindung zwischen Nathanael und der singenden und spielenden Puppe Olimpia geht so weit, dass der junge Student zu einer Verlobung entschlossen ist. Im Moment der geplanten Ringübergabe aber, die den Erfolg des Menschenexperimentes besiegelte, streiten sich die beiden Urheber der täuschend echten Menschenpuppe um ihre Leistungsanteile. Ausgetragen wird dieser Streit zwischen Spalanzani und Coppola an dem Automaten selbst, dessen Besitz und die daran sich anschließenden Einnahmen von beiden beansprucht werden. In ihrem enthemmten Ehrgeiz und Besitzanspruch, als Sinnbild der egoistischen Fundierung aller aufklärerischen Forschung, zerstören sie den Automaten. Und erst durch diese Zerrüttung wird Olimpia für den hinzukommenden Nathanael als Automat, als leblose Puppe erkennbar. Doch nicht diese Erkenntnis selbst wird zur Ursache für die manifeste Störung des Protagonisten. Erst Spalanzanis Aufforderung, den mit der Puppe flüchtenden Coppola zu verfolgen, weil der sein Lebenswerk zerstört und entwendet habe, und die Bekräftigung dieses Befehls durch das Bewerfen Nathanaels mit den am Boden liegenden künstlichen Augen, zerrütten die Psyche des hintergangenen Liebhabers: »Da packte ihn der Wahnsinn mit glühenden Krallen und fuhr in sein Inneres hinein Sinn und Gedanken zerreißend« (32/[38]). Erstmals äußert sich dieser psychische Verfall auch in Gewalt gegen andere: Nathanael versucht, Spalanzani zu erwürgen.
V Claras Verblendung und die Grenzen des Verstehens
Doch ist mit dieser erneuten Zerrüttung der Psyche des Protagonisten noch immer nicht das Ende der Erzählung von »Nathanaels verhängnisvollem Leben« erreicht. Auch aus dieser geistigen Umnachtung erwacht er erneut, diesmal gepflegt und umhegt von seiner Familie. Selbst Clara hat ihm alle Eskapaden verziehen und hofft nach erhaltener Erbschaft, die ein geruhsames Leben auf dem Lande verspricht, auf ein gemeinsames Leben mit Nathanael, denn: »Jede Spur des Wahnsinns war verschwunden« (34/[40]).
Bereits ein gemeinsamer Abschiedsbesuch auf dem Ratsturm der Heimatstadt zerstört aber diese Illusion und beweist, dass sowohl Clara als auch alle anderen Nathanael umgebenden Personen seine Krankheit eigentlich nie verstanden haben. Schon der erneut zufällige Griff nach Coppolas Perspektiv, das sich noch immer in seiner Jackentasche befindet, und ein Blick hindurch auf Clara vitalisiert nämlich den zerrütteten Teil seiner Psyche und lässt diesen zur Lebensgefahr für Clara werden:
»Da zuckte es krampfhaft in seinen Pulsen und Adern – totenbleich starrte er Clara an, aber bald glühten und sprühten Feuerströme durch die rollenden Augen, grässlich brüllte er auf, wie ein gehetztes Tier; dann sprang er hoch in die Lüfte und grausig dazwischen lachend schrie er in schneidendem Ton: ›Holzpüppchen dreh dich – Holzpüppchen dreh dich‹ – und mit gewaltiger Kraft fasste er Clara und wollte sie herabschleudern […].« (35/[41])
Читать дальше