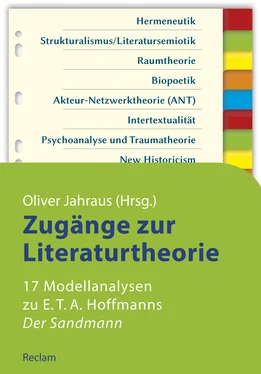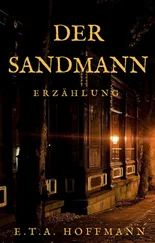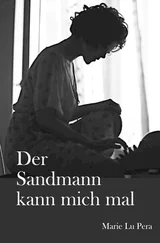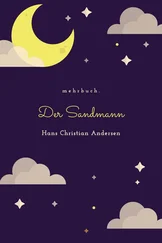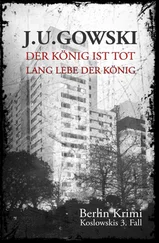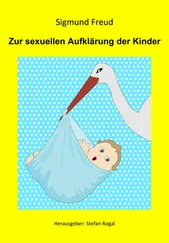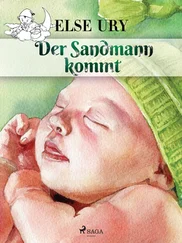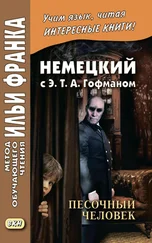Darüber hinaus macht sie ihrem Adressaten unmissverständlich klar, dass jeder selbst es ist, der unglückliche Einflüsse zu einer dunklen Macht stilisiert und dass der Einzelne daher frei ist, sich ihr zu unterwerfen oder sich von ihr zu lösen:
»Ich bitte dich, schlage dir den hässlichen Advokaten Coppelius und den Wetterglasmann Giuseppe Coppola ganz aus dem Sinn. Sei überzeugt, dass diese fremden Gestalten nichts über dich vermögen; nur der Glaube an ihre feindliche Gewalt kann sie dir in der Tat feindlich machen.« (17/[15])
Selbst mögliche Einwände ihres an das »Unheimliche« als Ordnungsmacht des Lebens glaubenden Verlobten vermag sie vorwegzunehmen. Dem Vorwurf, sie habe ein »kaltes« – also vernünftiges – »Gemüt«, entgegnet sie entschieden: Auch heitere, unbefangene Charaktere wie sie hätten durchaus eine »Ahnung […] von einer dunklen Macht, die feindlich uns in unserm eignen Selbst zu verderben« (16/[14]) drohe. Clara weist damit also mit Nachdruck den romantischen Vorwurf an die Begrenztheiten aufklärerischer Rationalität zurück.
Der weitere Verlauf der Erzählung wird deutlich machen, dass Clara mit vielen Momenten ihrer sachlich genauen und sprachlich klaren Analyse richtig liegt, dass sie also verstanden hat, dass, warum und woran Nathanael leidet. Diese pathographische Perspektive auf Nathanaels Psyche wird durch den weiteren Verlauf der Handlung bestätigt. Gleichwohl überschätzt Clara aber die Leistungsfähigkeit ihrer epistolaren »Aufklärung«, die in der schlichten Aufforderung zur heiteren Vernünftigkeit ihre praktische Seite hat. Zu Recht hält ein Interpret fest, dass ihre zutreffende »Diagnose […] noch keine Therapie« (Saße 2004, 99) sei. Clara ist also nicht, wie ihr Nathanael in seinem zweiten Brief und einige Zeitgenossen vorwerfen, zu vernünftig, mithin »kalt, gefühllos, prosaisch« (21/[21]). Vielmehr mangelt es ihr an einem angemessenen Verständnis zum therapeutischen Umgang mit der Krankheit ihres Verlobten, sie ist also nicht vernünftig genug, was für sie beinahe tödliche Folgen haben wird.
Nach diesem Entree in die Erzählung mit Hilfe dreier Briefe der beiden Protagonisten, die dem Leser sowohl den Charakter Nathanaels als auch denjenigen Claras anschaulich vorführen und dabei die entscheidenden Ereignisvoraussetzungen aus der Sicht der beiden Figuren entfalten, setzt ein außerhalb der Erzählung stehender, heterodiegetischer Erzähler die weitere Narration fort. Allerdings wird dieser erzähltechnisch ungewöhnliche Sachverhalt vom Erzähler selbst kommentiert, und zwar dadurch, dass er die Gründe für den Einsatz der Erzählung mit den Briefen der Protagonisten selbst angibt. In einer launigen, von ironischen Distanzierungssignalen geprägten Weise, die an die reflektierenden Erzähler Henry Fieldings (1707–1754) und Christoph Martin Wielands (1733–1813) erinnert, wird über die Schwierigkeit des Erzählens von Sachverhalten berichtet, die die Psyche eines Erzählers in besonderer Weise angehen und beherrschen. Zwar sei er von niemandem gebeten worden, doch empfinde er ein tiefes Verlangen, »von Nathanaels verhängnisvollem Leben zu dir [d. i. dem Leser] zu sprechen« (19/[18]). Weil er aber aufgrund seiner starken emotionalen Beteiligung keinen passenden Anfang gefunden habe, habe er beschlossen, »gar nicht anzufangen« (20/[19]) und mit den schon präsentierten Briefen seiner Figuren einzusetzen.
Erkennbar spielt der Erzähler hier ein doppeltes Spiel:5 Sein Bekenntnis zu einer begrenzten Leistungsfähigkeit in der Erzählung aufwühlender Sachverhalte lässt allererst die sprachliche Meisterschaft Nathanaels deutlich erkennen; das intersubjektive Desinteresse – niemand hat gefragt – an der nachfolgenden Geschichte erhöht die Neugierde des Lesers auf eine Begebenheit, die dem Erzähler so nahegeht, dass er sie kaum zu berichten vermag und zum – angeblich authentischen – Brief als Hilfsinstrument greift. Hoffmann spielt also – wie das Gros der Briefromane im 18. Jahrhundert – mit einer Authentizitätsfiktion (vgl. Anton 1995).
Darüber hinaus legitimiert er den epistolarischen Beginn und dessen abruptes Ende im Übergang zu einer Erzählweise, die zuvor die Briefform ausschloss (vgl. Picard 1971, S. 19 f.). Nur an dieser Scharnierstelle zwischen Brieferzählung und dem Auftritt des heterodiegetischen Erzählers tritt dieser sich selbst kommentierend auf, um den Bruch mit den Konventionen des Erzählens mit »Nathanaels verhängnisvollem Leben« (19/[18]) zu verknüpfen. Das Unverfügbare des Unheimlichen bedient sich der Verbindung des Unvermittelbaren: Briefform und starker Erzähler. Unter formalen Gesichtspunkten kann man die Erzählung folglich in drei Teile gliedern: 1. die drei Briefe; 2. die sich selbst kommentierende Erzählerreflexion und 3. den weiteren Bericht der Geschichte Nathanaels durch den Erzähler.
III Glauben und Wissen – das »Unheimliche« im Konflikt der Erkenntnisformen
Das ebenso problematische wie komplexe Verhältnis zwischen Glauben und Wissen, das in der immer wieder versuchten und doch unmöglichen Liebe zwischen Nathanael und Clara ausgetragen wird, prägt viele philosophische, einzelwissenschaftliche und literarische Debatten um 1800. So zeigt der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) in einer seiner frühesten Schriften,6 dass sich beide Erkenntnisformen gerade durch den Prozess der Aufklärung gegenseitig ebenso ausschließen wie bedingen, ohne diese erzwungene Abhängigkeit zu reflektieren (Hegel 1986).
Um dieses komplexe Verhältnis von Glauben und Wissen als einem entscheidenden Verständnishorizont der Erzählung präzise und anschaulich herauszuarbeiten, bedient sich der Erzähler in der Folge nach seinem Selbstkommentar verschiedener Techniken: Nach einer kurzen Ergänzung zur Vorgeschichte, die Nathanaels Leben in der Familie Claras und Lothars darstellt, gibt er eine ausführliche Charakteristik Claras, die den Handlungsverlauf zunächst nicht vorantreibt. Dabei erweist sich die weibliche Protagonistin zwar nicht als schöne, wohl aber als moralisch integre Person, was schon an ihrer Physiognomik abzulesen sei. Darüber hinaus sei sie mit »lebenskräftige[r] Fantasie« ausgestattet, vor allem aber durch einen »hellen scharf sichtenden Verstand« (21/[20]) ausgezeichnet, was ihr (nach zeitgenössischen Vorstellungen als Frau) den Vorwurf der Gefühllosigkeit einträgt. Insgesamt aber wird die Figur der Clara nicht nur durch ihren Brief, sondern auch vom Erzähler ausnehmend positiv gezeichnet.7
Nathanael dagegen erlebt durch das Treffen mit dem Wetterglashändler eine Bestätigung und Verschärfung seines Hanges zu den ir- bzw. transrationalen Vermögen des Menschen und dem mit ihrer Hinnahme bzw. sogar Nobilitierung einhergehenden religiösen Selbst- und Weltverhältnis. Im Zentrum dieser Einstellung steht die Überzeugung von der grundlegenden Unfreiheit des Menschen:
»Recht hatte aber Nathanael doch, als er seinem Freunde Lothar schrieb, dass des widerwärtigen Wetterglashändlers Coppola Gestalt recht feindlich in sein Leben getreten sei. […] Er versank in düstre Träumereien, und trieb es bald so seltsam, wie man es niemals von ihm gewohnt gewesen. Alles, das ganze Leben war ihm Traum und Ahnung geworden; immer sprach er davon, wie jeder Mensch, sich frei wähnend, nur dunklen Mächten zum grausamen Spiel diene, vergeblich lehne man sich dagegen auf, demütig müsse man sich dem fügen, was das Schicksal verhängt habe.« (21/[21])
Die erkenntnistheoretische Nobilitierung von Träumen und Ahnungen als Nacht- und Tagträume gehört zu den Grundzügen einer rationalitätskritischen Romantik, und zwar nicht allein in der Dichtung, sondern auch in den Wissenschaften. Die von Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775–1854) ausgehende romantische Naturforschung beschäftigte sich ausführlich mit diesen Vermögen des Menschen, weil sie wie Johann Heinrich Schubert (1800–1885) davon überzeugt war, dass der Mensch im Zustand des Traumes mit dem Jenseits kommuniziere und so einen höheren Bewusstseinszustand erreiche. Daher zählte es zu den Aufgaben des romantischen Wissenschaftlers, solche Träume zu deuten (vgl. u. a. Schubert 1968).
Читать дальше