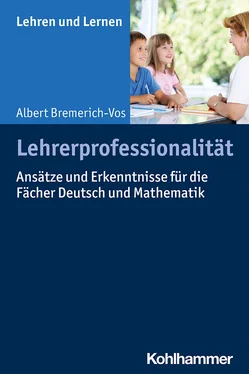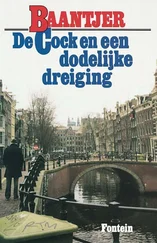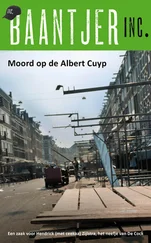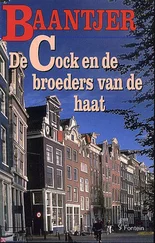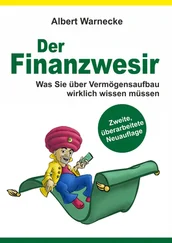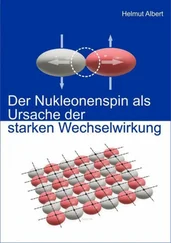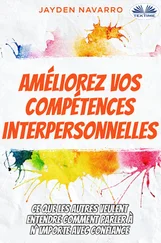• Extraversion: Ich habe gern viele Leute um mich herum. – Ich ziehe es gewöhnlich vor, Dinge allein zu tun.
• Verträglichkeit: Ich versuche zu jedem, dem ich begegne, freundlich zu sein. – Wenn ich Menschen nicht mag, so zeige ich ihnen das auch offen.
• Gewissenhaftigkeit: Ich versuche, alle mir übertragenen Aufgaben sehr gewissenhaft zu erledigen. – Ich werde wohl niemals fähig sein, Ordnung in mein Leben zu bringen.
• Neurotizismus (bzw. als Gegenpol: emotionale Stabilität): Ich empfinde selten Furcht oder Angst. – Wenn ich unter starkem Stress stehe, fühle ich mich manchmal, als ob ich zusammenbräche.
• Offenheit für Erfahrungen: Mich begeistern die Motive, die ich in der Kunst und in der Natur finde. – Ich finde philosophische Diskussionen langweilig.
Rammstedt & Danner (2016) werteten Daten aus Befragungen zu den Big Five (u. a. mithilfe des NEO-FFI) und ihrer Facetten aus, und zwar von drei Stichproben, darunter einer aus Studierenden (n = 453) und einer, die für die erwachsene Bevölkerung repräsentativ war (n = 1431). Es zeigte sich, dass das Alter positiv mit Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit und negativ mit Extraversion korrelierte. 2 2 Korrelationen können Werte zwischen -1 und +1 annehmen. Bei Werten größer als 0 liegt ein positiver Zusammenhang vor, bei Werten unter 0 ein negativer. Werte ab etwa 0,3 (bzw. -0,3) zeigen mittlere, ab 0,5 (bzw. -0,5) starke Zusammenhänge an. Bei den Big Five handelt es sich um Konstrukte bzw. latente Variablen. Sie liegen den verschiedenen Indikatoren bzw. beobachtbaren (manifesten) Variablen zugrunde, d. h. den Antworten auf die Items, die jeweils zu einer latenten Variablen gehören. Bei den manifesten Variablen ist immer mit einem mehr oder weniger großen Messfehler zu rechnen, sie können nicht »perfekt« gemessen werden. Auch Zusammenhänge von manifesten Variablen sind damit »messfehlerbehaftet«. Die Korrelationen zwischen latenten Variablen in einem Strukturmodell (z. B. zwischen Gewissenhaftigkeit und Extraversion) sind dagegen »messfehlerbereinigt«. Es werden »wahre« Werte korreliert und die Korrelationen fallen höher aus als die zwischen manifesten Variablen.
Frauen hatten im Mittel höhere Werte bei Verträglichkeit und emotionaler Stabilität. Mit dem Bildungsniveau der Befragten (von »ohne Abschluss« bis »abgeschlossenes Studium«) korrelierten Extraversion und vor allem Offenheit (ebd., S. 78f.).
Allein auf Studierende zielte eine Metaanalyse von Trapmann, Hell, Hirn & Schuler (2007). Sie werteten 58 englisch- und deutschsprachige Studien aus und fanden heraus, dass nur der Faktor Gewissenhaftigkeit zur Aufklärung von Unterschieden bei den Studiennoten beitrug, wenn auch nur in geringem Maß (7 %) (ebd., S. 145).
Klusmann et al. (2009) befragten in Baden-Württemberg zunächst (»prospektiv«) Gymnasiastinnen und Gymnasiasten im letzten Schuljahr mit dem NEO-FFI und zwei Jahre später ermittelten sie diejenigen aus dieser Stichprobe, die nun an Pädagogischen Hochschulen und Universitäten ein Lehramts- oder ein anderes Studium aufgenommen hatten. Bei keinem Persönlichkeitsmerkmal waren Unterschiede zwischen Studierenden, die ein Lehramt an Gymnasien anstrebten, und anderen an Universitäten Studierenden auszumachen. Differenzen zeigten sich allerdings zwischen den »Fraktionen« der Lehramtsstudierenden. Die an Pädagogischen Hochschulen Studierenden, die Lehrämter an Grund-, Haupt-, Real- und Sonderschulen anstrebten, schrieben sich selbst weniger Offenheit für neue Erfahrungen zu als die Gymnasialen (d =0.62), aber mehr soziale Verträglichkeit (d =0.3) (ebd., S. 273).
Auf das Fach Mathematik war eine Untersuchung von Klusmann, Kunter, Voss & Baumert (2012) bezogen. Im Rahmen der Studie COACTIV-Referendariat befragten sie mit dem NEO-FFI insgesamt 551 Personen – und zwar zwei Kohorten von angehenden Mathematik-Lehrkräften jeweils zeitgleich zweimal, die eine Kohorte zu Beginn (Zeitraum 1) und am Ende des ersten Ausbildungsjahres (Zeitraum 2), die zweite am Anfang (Zeitraum 1) und am Ende des zweiten Jahres (Zeitraum 2). Untersucht wurde u. a., ob bzw. wie sich die Big Five auf die emotionale Erschöpfung und die berufliche Zufriedenheit auswirkten. Es zeigte sich, dass zu beiden Messzeitpunkten vor allem geringerer Neurotizismus, also erhöhte emotionale Stabilität, in geringerem Maß auch Gewissenhaftigkeit und Extraversion mit weniger emotionaler Erschöpfung und höherer beruflicher Zufriedenheit einhergingen (ebd., S. 283). Zum ersten Messzeitpunkt trugen nur höherer Neurotizismus und geringere Gewissenhaftigkeit statistisch signifikant zur Erklärung von emotionaler Erschöpfung bei und die berufliche Zufriedenheit konnte – analog – durch niedrigere emotionale Stabilität und größere Gewissenhaftigkeit vorhergesagt werden. Längsschnittliche Analysen ergaben, dass Unterschiede bei der emotionalen Erschöpfung und bei der Berufszufriedenheit zum zweiten Messzeitpunkt wiederum durch eine Tendenz zu negativen Emotionen und Labilität (Neurotizismus) vorhergesagt werden konnten, in geringerem Maß aber auch durch das Persönlichkeitsmerkmal Offenheit für neue Erfahrungen. »Lehramtskandidaten mit einer höheren Offenheit für neue Erfahrungen berichten am Ende des Schuljahres sowohl höhere emotionale Erschöpfung als auch geringere Berufszufriedenheit.« (ebd., S. 286) Dieser Befund lädt zu Spekulationen ein. Womöglich spielt hier die Enttäuschung darüber eine Rolle, dass in der Institution Schule der Spielraum für die Erprobung von »Neuem« sehr begrenzt ist.
Mayr (2014, S. 205) resümierte die Ergebnisse einiger u. a. von ihm selbst verantworteter Studien, an denen in Österreich (angehende) Grundschul-, Hauptschul- und Sonderschulpädagoginnen und -pädagogen teilgenommen hatten. Es zeigte sich, dass Gewissenhaftigkeit die Aneignung von Theorien im Studium begünstigte, allerdings nicht das später erhobene pädagogische Können.
Als Fazit lässt sich festhalten, »dass einerseits von einer Negativselektion in das Lehramtsstudium generell nicht gesprochen werden kann.« (Rothland, 2014, S. 341) Andererseits ist nicht zu verkennen, dass bei kognitiven Fähigkeitstests und Abiturdurchschnittsnoten (zumindest) Studierende für ein Lehramt in der Sekundarstufe I erheblich schlechter abschneiden als Studierende für ein Lehramt am Gymnasium. Die Abiturnote ist nicht nur ein starker Prädiktor von Studienleistungen, sondern auch noch von Noten am Ende des Vorbereitungsdienstes. Zur Vorhersage der Qualität des Unterrichts dagegen trägt sie nicht bei.
Die Befunde deuten darauf hin, dass Lehramtsstudierende primär intrinsisch motiviert sind. Das fachliche Interesse, der Umgang mit Kindern und Jugendlichen und das Motiv, soziale Verantwortung zu übernehmen, sind bei ihnen deutlicher ausgeprägt als bei anderen Studierenden und bei SI-Studierenden wiederum stärker als bei Gymnasialen. Extrinsische Motive wie die Länge der Schulferien, der Beamtenstatus und das Gehalt spielen zwar auch eine Rolle, sind aber nachrangig. Im Vergleich mit anderen Studierenden sind Lehramtsstudierende weniger an intellektuell-forschenden Tätigkeiten interessiert, wobei nach Fächern und Lehrämtern zu differenzieren ist.
Im Hinblick auf Persönlichkeitsmerkmale wie die sogenannten Big Five unterscheiden sich Lehramtsstudierende nicht von anderen Studierenden. Fachunabhängig begünstigt insbesondere Gewissenhaftigkeit den Studienerfolg. Vor allem emotionale Stabilität (negativ: Neurotizismus) und auch noch Gewissenhaftigkeit und Extraversion bewahren vor emotionaler Erschöpfung und tragen zu beruflicher Zufriedenheit bei. Offenheit für neue Ideen und (ästhetische) Erfahrungen dürfte bei Gymnasialen ausgeprägter sein als bei Nicht-Gymnasialen. Belege für einen Zusammenhang zwischen einzelnen oder mehreren der Big Five und der Unterrichtsqualität oder dem Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler sind im deutschsprachigen Raum dagegen noch nicht erbracht worden.
Читать дальше