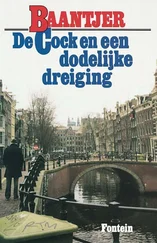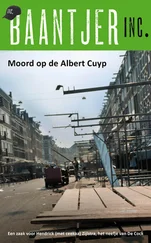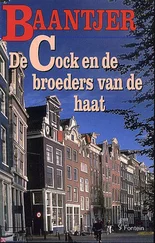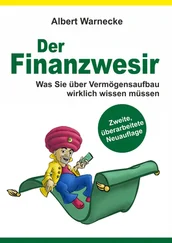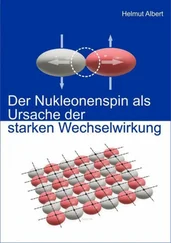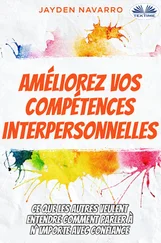• Unterricht fachgerecht zu planen und durchzuführen und dabei heterogene Lernvoraussetzungen zu bedenken,
• Lernsituationen mit dem Ziel zu gestalten, Schülerinnen und Schüler zu motivieren und zu befähigen, Zusammenhänge herzustellen und Gelerntes zu nutzen,
• schließlich ihre Fähigkeit zu selbstbestimmtem Lernen und Arbeiten zu fördern.
Diesen drei Kompetenzen sind 28 Standards zugeordnet, allen elf Kompetenzen insgesamt 105. Im Kompetenzbereich Unterrichten für die primär theoretischen Ausbildungsabschnitte, also das Studium, handelt es sich z. B. um die folgenden Standards: »Die Absolventinnen und Absolventen …
• kennen die einschlägigen Erziehungs- und Bildungstheorien, verstehen bildungs- und erziehungstheoretische Ziele sowie die daraus abzuleitenden Standards und reflektieren diese kritisch.
• kennen allgemeine und fachbezogene Didaktiken und wissen, was bei der Planung von Unterrichtseinheiten auch in leistungsheterogenen Gruppen beachtet werden muss.
• kennen unterschiedliche Unterrichtsmethoden, Aufgabenformate bzw. Aufgabenformen und wissen, wie man sie anforderungs- und situationsgerecht einsetzt.
• kennen Lerntheorien und Formen des Lernens einschließlich Theorien des Lehrens und Lernens mit digitalen Medien.
• kennen Grundlagen und Ergebnisse der Schul- und Unterrichtsforschung und können diese anwendungsbezogen reflektieren.« (ebd., S. 7f.)
Es fällt auf, dass die Ausführungen zu den Bildungswissenschaften viel detaillierter sind als die zu den Fächern und Fachdidaktiken. Nur im Hinblick auf die ersteren ist von Standards die Rede und deren Liste ist lang. Die Texte lassen sich als Resultate einer Gratwanderung verstehen. Einerseits waren Vorgaben zu formulieren, andererseits sollte nicht der Eindruck entstehen, hochschulische und andere Akteure würden zu stark gegängelt. Bei den Bildungswissenschaften war man offensichtlich eher bereit, den Vorwurf der Gängelung in Kauf zu nehmen. Die KMK-Dokumente sollten jedenfalls nicht als bildungspolitische Verlautbarungen verstanden werden, die für die Arbeit in den Hochschulen und in der zweiten Phase der Lehrerausbildung weitgehend folgenlos sind. Denn die »Standards für die Bildungswissenschaften bilden zusammen mit den Anforderungen für die Fachwissenschaften und Fachdidaktiken eine Grundlage für die Akkreditierung und Evaluierung von lehramtsbezogenen Studiengängen.« (KMK, 2019b, S. 3) Sie sollen also Eingang in die hochschulischen Curricula finden und können insofern als Teil eines intendierten Curriculums verstanden werden. Für die Akkreditierung dürfte es günstig sein, wenn in Modulbeschreibungen oder in Beschreibungen einzelner Lehrveranstaltungen die von der KMK formulierten Kompetenzerwartungen zu finden sind. Vom institutionell vorgegebenen und sich in Studien- und Prüfungsordnungen manifestierenden, intendierten Curriculum ist aber das implementierte Curriculum zu unterscheiden. Darüber, ob tatsächlich das gelehrt wurde, was das intendierte Curriculum verspricht, können vor allem die Studierenden bzw. die Absolventinnen und Absolventen Auskunft geben und es ist durchaus zu erwarten, dass es in ihrer Warte zu mehr oder weniger großen Diskrepanzen zwischen intendiertem und realisiertem Curriculum gekommen ist. Hatten sie überhaupt die Gelegenheit, sich die curricular »versprochenen« fachspezifischen und bildungswissenschaftlichen Kompetenzen anzueignen (  Kap. 8)? Schließlich kann gefragt werden, inwiefern sie die Lerngelegenheiten genutzt haben und inwieweit es zu Lernerfolgen gekommen, das Curriculum also gewissermaßen realisiert worden ist (
Kap. 8)? Schließlich kann gefragt werden, inwiefern sie die Lerngelegenheiten genutzt haben und inwieweit es zu Lernerfolgen gekommen, das Curriculum also gewissermaßen realisiert worden ist (  Kap. 6und 7).
Kap. 6und 7).
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
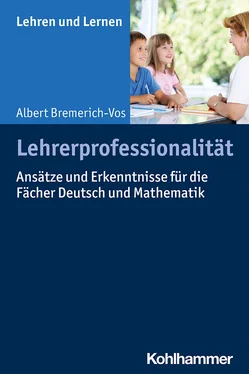
 Kap. 8)? Schließlich kann gefragt werden, inwiefern sie die Lerngelegenheiten genutzt haben und inwieweit es zu Lernerfolgen gekommen, das Curriculum also gewissermaßen realisiert worden ist (
Kap. 8)? Schließlich kann gefragt werden, inwiefern sie die Lerngelegenheiten genutzt haben und inwieweit es zu Lernerfolgen gekommen, das Curriculum also gewissermaßen realisiert worden ist (