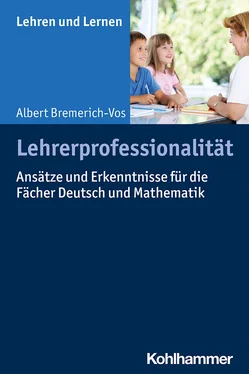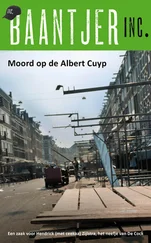Der kompetenztheoretische Ansatz hat seine Wurzeln in der Psychologie, u. a. in der Expertiseforschung. In den einschlägigen Arbeiten werden in der Regel nicht wenige »Fälle« interpretiert, sondern große Gruppen getestet bzw. befragt und die Befunde werden quantitativ-statistisch ausgewertet.
Anders als die Publikationen zu diesen beiden Ansätzen sind diejenigen, die man nach Terhart dem berufsbiographischen Ansatz zuordnen könnte, in methodischer Hinsicht disparat, d. h. einmal quantitativ, einmal qualitativ ausgerichtet. Deshalb folge ich in diesem Punkt seinem Vorschlag nicht, greife aber Fragestellungen, um die es hier geht, an verschiedenen Stellen auf. Auch im von Terhart, Bennewitz & Rothland herausgegebenen »Handbuch der Forschung zum Lehrerberuf« (2014) wird nicht von einem berufsbiographischen Ansatz gesprochen. Es enthält aber u. a. einen Beitrag zum sogenannten Persönlichkeitsansatz. Persönlichkeit wird hier als »Ensemble relativ stabiler Dispositionen« (Mayr, 2014, S. 191) verstanden und es wird u. a. gefragt, ob Personenmerkmale zu finden sind, die zur Erklärung des Erfolgs von Lehrkräften beitragen. In Kapitel 2.3 dieses Buchs wird auf diesen Ansatz eingegangen.
Die Forschung zur Lehrerprofessionalität ist ein weites, für einen Einzelnen m. E. mittlerweile zu weites Feld, um mit dem alten Briest aus Fontanes Roman zu sprechen. Deshalb waren in mehrfacher Hinsicht Beschränkungen angezeigt:
• Von Ausnahmen abgesehen, kommen hier Studien aus den letzten 15 Jahren zur Sprache.
• Zwar ist die internationale Diskussion lebhaft und verzweigt, ich konzentriere mich aber auf Texte in deutscher und englischer Sprache, die von deutschsprachigen Autorinnen und Autoren verfasst wurden. Deren Auswahl ist subjektiv – aber nur zum Teil. Es gibt nämlich einige »Meilensteine«, d. h. Publikationen, die für die Debatte über Lehrerprofessionalität besonders anregend waren und sind.
Wenn die Studien zur Lehrerprofessionalität nicht wie häufig bildungswissenschaftlich orientiert sind, sondern einen Fachbezug haben, dann dominiert die Mathematik. Wollte man eine Rangliste aufstellen, dann kämen an zweiter Stelle die naturwissenschaftlichen und erst dann geisteswissenschaftliche Fächer. Mir als Deutschdidaktiker liegt das Fach Deutsch besonders am Herzen. Deshalb konzentriere ich mich im Folgenden im Wesentlichen auf Arbeiten zu (zukünftigen) Mathematik- und Deutschlehrkräften.
• Ausgespart sind Arbeiten zu Lehrkräften, die Mathematik oder Deutsch in der Grundschule unterrichten. Im Zentrum stehen Studien zu Sekundarstufenlehrerinnen und -lehrern.
• Lehrkräfte haben nicht nur zu unterrichten, sondern z. B. auch Eltern zu beraten und sich an der Entwicklung ihrer Schule zu beteiligen. Hier steht das Unterrichten im Zentrum, aber einige seiner Aspekte bleiben ausgespart. So bleibt z. B. ausgeklammert, was professionelles Handeln im Zeichen von Inklusion und Digitalisierung ausmachen könnte. Für eine mehr als oberflächliche Erörterung dieser Fragen fehlte der Platz.
Klaus-Jürgen Tillmann (2014, S. 314) resümierte, nachdem er mehrere Beiträge zum Stand der Forschung zum Lehrerberuf knapp referiert und kommentiert hatte, ernüchtert, dass sich die Verfechter eines qualitativen Ansatzes auf der einen und diejenigen, die einen primär quantitativen Zugang bevorzugen, auf der anderen Seite wenig zu sagen hätten. »Dies bestätigt die These, dass es hier offensichtlich zwei klar voneinander getrennte wissenschaftliche Arenen mit deutlich anderen Akteuren gibt, die sich in ihrer wissenschaftlichen Arbeit kaum aufeinander beziehen.« Es gibt zwar einige Versuche, Brücken zu bauen, aber Tillmanns Fazit hat im Großen und Ganzen auch heute noch Bestand. Ich habe mich bemüht, beiden »Richtungen« gerecht zu werden, mich von Fall zu Fall aber auch nicht vor Wertungen gescheut.
2 Wer will Lehrkraft werden und warum?
Handelt es sich bei Lehramtsstudierenden um eine Negativauswahl, um eine Gruppe also, die durchschnittlich schlechtere Abiturnoten hat als andere Studierende? Was lässt sich über ihre kognitiven Eingangsvoraussetzungen sagen und welchen Einfluss haben sie auf ihre Leistungen in späteren Phasen der Ausbildung? Welche Interessen und Berufswahlmotive lassen sich ausmachen? Welche Bedeutung haben Persönlichkeitsmerkmale für die Wahl eines Lehramtsstudiums, aber auch für berufliches Befinden? Auf diese Fragen wird im Folgenden eingegangen. Studien, in denen es um die soziale Herkunft von Lehramtsstudierenden und Lehrkräften und darum geht, in welchem Ausmaß der Lehrerberuf sozial »vererbt« ist, bleiben hier außer Betracht (s. dazu Rothland, 2014, S. 321–329).
2.1 Kognitive Voraussetzungen zu Studienbeginn und ihr Einfluss auf Testergebnisse und Abschlussnoten
Es ist weitgehend unbestritten, dass die Abiturdurchschnittsnote der beste Einzelprädiktor für den Studienerfolg ist. Im Mittel werden Korrelationen der Durchschnittsnote und späteren fachspezifischen Leistungen im Verlauf des Studiums und vor allem in Form von Studienabschlussnoten um r = .40 berichtet (Gold & Souvignier, 2005, S. 215). Klusmann, Trautwein, Lüdtke, Kunter & Baumert (2009) erhoben im Rahmen einer Längsschnittstudie in Baden-Württemberg im letzten Jahr der gymnasialen Oberstufe die kognitive Grundfähigkeit, mathematisches Wissen, Englischkenntnisse und Abiturnoten von 4730 Schülerinnen und Schülern. Zwei Jahre später verglichen sie die Befunde anhand einer Teilstichprobe von Studierenden, und zwar differenziert nach nichtgymnasialem (209 an Pädagogischen Hochschulen Studierenden) und gymnasialem Lehramt (119 an Universitäten Studierenden) auf der einen Seite und anderen, nicht lehramtsbezogenen Studiengängen an Universitäten (N = 1418) und Fachhochschulen bzw. Berufsakademien (N = 505) auf der anderen Seite. Die Abiturnoten der Studierenden des Gymnasiallehramts und der »Nicht-Lehrämtler« an Universitäten waren die besten und unterschieden sich nicht, am schwächsten und mit deutlichem Abstand (eine halbe Notenstufe) schnitten die nichtgymnasialen Lehramtsstudierenden ab (ebd., S. 271). Der Unterschied der Mittelwerte der beiden Lehramtsgruppen betrug, in Effektstärken d nach Cohen ausgedrückt, 0.99, machte also eine ganze Standardabweichung aus. 1 1 Cohens d als ein Maß für die Stärke eines Effekts bezeichnet die Differenz der Mittelwerte zweier Gruppen, geteilt durch die gemittelte Standardabweichung. Die Standardabweichung ist eine Maßzahl für die durchschnittliche Abweichung der Einzelwerte vom Mittelwert einer Verteilung. Wenn die Werte normalverteilt sind, dann bedeutet eine Effektstärke von d= 1.00, dass eine durchschnittliche Schülerin bzw. ein durchschnittlicher Schüler am Gymnasium bessere Noten hat als mehr als 80 Prozent der Nicht-Gymnasialen. d-Werte ab 0.20 können als kleiner, ab 0.50 als mittlerer und ab 0.80 als großer Effekt angesehen werden. Die Berechnung von d oder eines anderen Maßes für die Effektstärke ist wichtig, weil bei großen Stichproben auch sehr kleine Effekte statistisch signifikant sein können. Wird zusätzlich die Effektstärke angegeben, kann beurteilt werden, inwiefern ein signifikanter Befund auch praktisch bedeutsam ist. 2 Korrelationen können Werte zwischen -1 und +1 annehmen. Bei Werten größer als 0 liegt ein positiver Zusammenhang vor, bei Werten unter 0 ein negativer. Werte ab etwa 0,3 (bzw. -0,3) zeigen mittlere, ab 0,5 (bzw. -0,5) starke Zusammenhänge an. Bei den Big Five handelt es sich um Konstrukte bzw. latente Variablen. Sie liegen den verschiedenen Indikatoren bzw. beobachtbaren (manifesten) Variablen zugrunde, d. h. den Antworten auf die Items, die jeweils zu einer latenten Variablen gehören. Bei den manifesten Variablen ist immer mit einem mehr oder weniger großen Messfehler zu rechnen, sie können nicht »perfekt« gemessen werden. Auch Zusammenhänge von manifesten Variablen sind damit »messfehlerbehaftet«. Die Korrelationen zwischen latenten Variablen in einem Strukturmodell (z. B. zwischen Gewissenhaftigkeit und Extraversion) sind dagegen »messfehlerbereinigt«. Es werden »wahre« Werte korreliert und die Korrelationen fallen höher aus als die zwischen manifesten Variablen.
Analog, wenn auch nicht durchgängig so deutlich, fielen die Ergebnisse bei den anderen Leistungsindikatoren (kognitive Grundfähigkeit, Mathematik und Englisch) aus. Wurden nur gymnasiale Lehramtsstudierende mit MINT-Fächern mit anderen Studierenden verglichen, die MINT ohne Lehramtsbezug studierten, ergaben sich keine Unterschiede im kognitiven Bereich, ebenfalls nicht beim Vergleich von Lehramtsstudierenden und anderen Studierenden, die keine MINT-Fächer studierten (Roloff Henoch, Klusmann, Lüdtke & Trautwein, 2015a).
Читать дальше