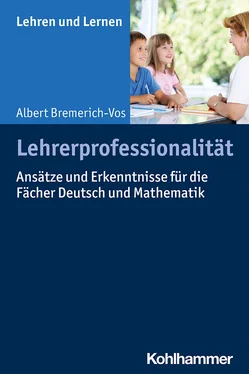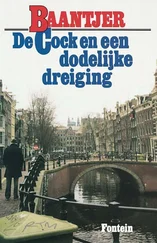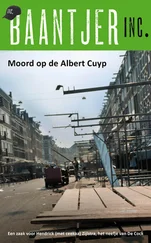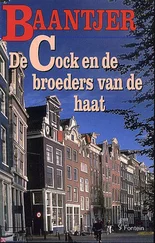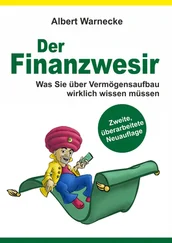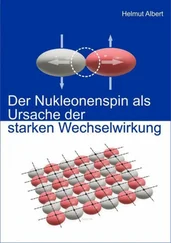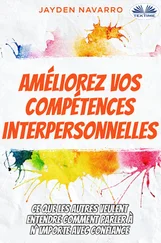Blömeke (2009) berichtete über eine längsschnittlich angelegte Studie, in deren Rahmen u. a. die Abiturdurchschnittsnoten von 609 Absolventinnen und Absolventen eines Diplom-Studiums in Mathematik und 483 Mathematik-Gymnasiallehrkräften erhoben wurden. Unterschiede waren hier nicht auszumachen.
Damit wurden ältere Befunde von Gold & Giesen (1993) weitgehend bestätigt, die ebenfalls zunächst Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf fachliches Wissen und Intelligenz getestet, die Abiturnote erfragt und in der Folge Teilstichproben dieser Schülerinnen und Schüler untersucht hatten, die nun Studierende waren. Die »Gymnasialen« hatten bessere Testergebnisse und Abiturnoten vorzuweisen als Studierende der Sekundarstufe I, der Haupt-, Grund- und Sonderschule. Auch hier ergaben sich für die Gymnasialen und Diplom- und Magisterstudierende der gleichen Fachrichtung (Mathematik und Naturwissenschaften, Sprachen und andere Geisteswissenschaften) keine bedeutsamen Unterschiede.
Gold & Giesen (1993) und Klusmann et al. (2009) unterschieden nur gymnasiale und nicht-gymnasiale Lehramtsstudierende. Spinath, van Ophuysen & Heise (2005) differenzierten anhand einer Stichprobe Dortmunder Studierender bei den Nicht-Gymnasialen und berichteten u. a. separate Ergebnisse für Studierende der Lehrämter für die Primarstufe, der Sekundarstufe I und der Sonderpädagogik. Sie setzten den Grundintelligenztest CFT 3 (Weiss, 1971) ein und fanden heraus, dass sich Primarstufen- und Sekundarstufen-II-Studierende nicht unterschieden. Sekundarstufen-I-Studierende schnitten deutlich, wenn auch nicht signifikant schlechter ab, Studierende der Sonderpädagogik markant besser (ebd., S. 191).
Diesen anhand einer kleinen Stichprobe ermittelten Befund konnte Neugebauer (2013) nicht bestätigen. Er untersuchte die Angaben von fast 15 000 Personen, die vom HIS-Institut für Hochschulforschung kurz nach Erhalt ihrer Hochschulzugangsberechtigung postalisch befragt worden waren. Verglichen werden konnten die Abiturdurchschnittsnoten von (zukünftigen) Studierenden des Lehramts am Gymnasium (n = 843), der Lehrämter für Grund-, Haupt-, Real- und Sonderschule (n = 1028) und Nicht-Lehramtsstudierender an Universitäten (n = 9813) und Fachhochschulen (n = 3131). Es ergab sich, dass die Nicht-Lehramtsstudierenden an Universitäten die besten Abiturnoten hatten (2,21). Sie unterschieden sich nicht signifikant von denen der Gymnasialen (2,25). FH-Studierende schnitten signifikant schlechter ab (2,42), am schlechtesten die nicht-gymnasialen Lehramtsstudierenden (2,62), bei denen die internen Unterschiede nicht oder kaum ins Gewicht fielen. Der Unterschied zwischen Gymnasialen und Nicht-Gymnasialen kann als mittlerer Effekt (d= 0.59) verstanden werden (ebd., S. 170f.).
Im Rahmen des interdisziplinären Projekts TEDS-LT (Blömeke et al., 2011) wurden u. a. die Abiturdurchschnittsnoten von 588 Deutsch- und 453 Mathematikstudierenden erhoben und nach Schulformen differenziert. In Mathematik unterschieden sich die Noten der Studierenden für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen um eine halbe Notenstufe von denen der Haupt- und Realschul-Studierenden, in Deutsch um 0,3 Notenpunkte. Bei den fachspezifischen Tests im dritten bis fünften Semester schnitten Gymnasiale in Literaturwissenschaft und Linguistik um etwa eine halbe Standardabweichung besser ab als die Nicht-Gymnasialen, die Differenzen bei Arithmetik und Algebra waren noch markanter und betrugen fast eine Standardabweichung. Wurden weitere Hintergrundmerkmale kontrolliert, ging in beiden Fächern ein um eine Note besseres Abiturergebnis mit einer um eine halbe Standardabweichung besseren Testleistung einher (Blömeke & Buchholtz, 2011, S. 189, S. 192).
Für Referendarinnen und Referendare, die überwiegend Mathematik studiert hatten, ergab die Studie COACTIV-R, an der 856 Lehramtsanwärterinnen und -anwärter teilnahmen, dass ihre Abiturgesamtnoten nicht von denen anderer Abiturientinnen und Abiturienten (im Schuljahr 2004/05) abwichen. Erneut unterschieden sich aber die Noten der angehenden Gymnasiallehrkräfte von den Noten derer, die ein Lehramt an Grund-, Haupt-, Real- und Gesamtschulen anstrebten, und zwar beträchtlich, d. h. um mehr als eine Standardabweichung (Cohens d = 1,22). Auch die Werte beim Kognitiven Fähigkeitstest (KFT) fielen zugunsten der Gymnasialen aus, wenn auch weniger deutlich (Klusmann, 2011a, S. 299).
Für einen Teil der COACTIV-R-Stichprobe wurden nicht nur kognitive Grundfähigkeit und Abiturnoten erhoben, sondern auch die Studienabschlussnoten in Mathematik und die Abschlussnoten des Vorbereitungsdienstes. Darüber hinaus schätzten Schülerinnen und Schüler von 190 (von insgesamt 242) Lehramtsanwärterinnen und -anwärtern die Qualität ihres Unterrichts in den drei Dimensionen kognitive Aktivierung, Klassenführung und Unterstützung ein ( 
Kap. 7
). Hinzu kam eine Stichprobe von 668 Referendarinnen und Referendaren aus NRW, deren Fächerspektrum breit war. Auch bei ihnen wurden Abiturnoten und Abschlussnoten nach der ersten und zweiten Phase erfragt. Schülerinnen und Schüler von 60 Lehrkräften beurteilten darüber hinaus die Qualität ihres Unterrichts. Bei beiden Stichproben ergab sich, dass die Noten am Ende des Studiums und auch noch am Ende des Referendariats von der Abiturnote vorhergesagt wurden (Wolf, Kunina-Habenicht, Maurer & Kunter, 2018, S. 109). »Gute Schülerinnen und Schüler werden demnach auch eher gute Lehramtsstudierende und erreichen auch eher gute Noten im Vorbereitungsdienst.« (Ebd.) Die Qualität des Unterrichts in der Perspektive der Schülerinnen und Schüler, also ein wesentlicher Aspekt beruflichen Erfolgs, konnte mithilfe der Abiturnote aber nicht vorhergesagt werden.
2.2 Interessen und Berufswahlmotive von Lehramtsstudierenden allgemein und fachspezifisch
Nach Holland (1997) lassen sich mehrere grundlegende und bei Erwachsenen weitgehend stabile berufliche Orientierungen und damit korrespondierende Umwelten unterscheiden: eine praktisch-technische, eine intellektuell-forschende, eine künstlerisch-sprachliche, eine soziale und eine ordnend-verwaltende Orientierung. Je nachdem, wie die Konstellation dieser Orientierungen bei ihnen beschaffen ist, suchen sich Menschen Umwelten, in denen ihre Interessen möglichst gut zur Entfaltung kommen. Holland (1997, S. 270) ging davon aus, dass bei Lehrkräften die soziale Orientierung dominant ist. Klusmann et al. (2009) befragten zunächst Schülerinnen und Schüler in 12. Klassen und verglichen zwei Jahre später die Befunde für diejenigen, die ein Lehramtsstudium gewählt hatten, mit den Ergebnissen der Studierenden, die an einer Universität studierten und kein Lehramt anstrebten (314 vs. 913 Studierende). Die Nicht-Lehramtsstudierenden hatten zwei Jahre früher u. a. ein deutlich höheres praktisch-technisches (z. B. untersuchen, wie etwas funktioniert) und intellektuell-forschendes (z. B. wissenschaftliche Artikel lesen) Interesse als die Gymnasialen gezeigt (d= 0.71 bzw. d= 0.64). Die Gymnasialen wiederum waren stärker sozial orientiert (z. B. sich Probleme anderer Menschen anhören) und zeigten auch größeres künstlerisch-sprachliches Interesse (z. B. Geschichten schreiben) (d= 0.59 bzw. d= 0.42). (Ebd., S. 272) Der interne Vergleich der Lehramtsstudierenden ergab nur Differenzen bei den sozialen und intellektuell-forschenden Interessen. Die Nicht-Gymnasialen waren stärker sozial (d= 0.56) und weniger intellektuell-forschend orientiert als die Gymnasialen (ebd.).
Kaub et al. (2012) untersuchten die beruflichen Orientierungen von Lehramtsstudierenden differenziert nach Fächerkombinationen. Für insgesamt 227 Studierende der Universität Saarbrücken wurden zu Studienbeginn fünf Fächerkombinationen ausgemacht. Der Vergleich zwischen Studierenden der Naturwissenschaften (Mathematik, Biologie, Chemie, Physik und Ingenieurwissenschaften) und von Sprachen (Kombination aus zwei Sprachen) ergab ein auffällig größeres intellektuell-forschendes Interesse bei den Naturwissenschaftlern, während die »Sprachler«, nicht verwunderlich, deutlich künstlerisch-sprachlich, aber auch in sozialer Hinsicht interessierter waren (ebd., S. 240ff.).
Читать дальше