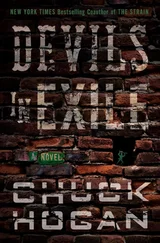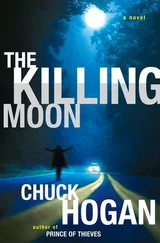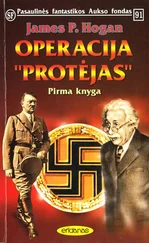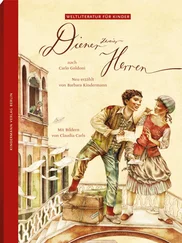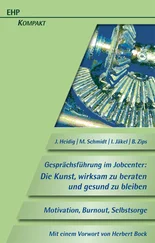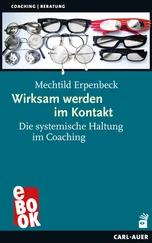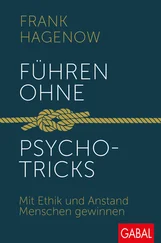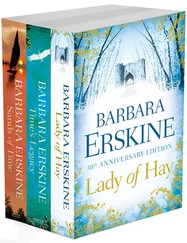Für die erfolgreiche Arbeit des Teams und seine wirkungsvolle Entwicklung ist es wichtig, die folgenden Fragen zu klären:
1. Wer hat die Verantwortung im Team?
Mit eindeutigen Absprachen darüber, wer die Verantwortung für das Team und dessen Entwicklung trägt, werden die Verantwortungsbereiche festgelegt und die Rollen verteilt.
2. Wie fügt sich das Team in die Klinik ein, wie sind die Schnittstellen zu anderen Bereichen?
Es reicht nicht aus, Organisationseinheiten einfach zu Teams zu erklären. Sie müssen in die bestehende Organisation eingefügt und mit Organigrammen, Stellen- und Aufgabenbeschreibung, Zielvereinbarungen und Budgets zu einer handlungsfähigen Einheit entwickelt werden.
3. Welche Handlungsspielräume braucht das Team? Ablaufbedingt hat ein Team einen bestimmten Rahmen, in dem es seine Handlungsspielräume entwickeln kann. Um die Teamentwicklung zu begünstigen und die Leistungen des Teams zu fördern, sollten die Handlungsspielräume für das Team möglichst weitreichend sein. Grundsätzlich braucht jedes Team Führung.
4. Wie wird die tägliche Arbeit organisiert?
Zu den Basisanforderungen der Organisation gehört die Ausstattung des Arbeitsbereiches mit geeigneten Geräten, Räumlichkeiten, Kommunikationsmitteln usw. Es gehört zu den Koordinationsaufgaben der Leitung, initial für das Funktionieren der Organisation zu sorgen und im Sinne der Selbstorganisation an das Team zu delegieren.
 Zielklarheit, Zieltransparenz und Zielverbindlichkeit bestimmen die Teamidentität
Zielklarheit, Zieltransparenz und Zielverbindlichkeit bestimmen die Teamidentität 
Ein wichtiges Merkmal von Top-Teams, wie sie in Kliniken zu finden sind, ist die konsequente Verfolgung von Zielen. Zielklarheit, Zieltransparenz und Zielverbindlichkeit sind wesentliche Bestandteile der Teamidentität. Eine klare Zielorientierung verhindert Desorientierung und dient der Weiterentwicklung. Daher sollten Ziele für alle verständlich formuliert und einvernehmlich vereinbart werden. Dabei gilt es auch, die folgenden Begleitumstände im Blick zu behalten (Hollmann, 2010):
• Sind die gewählten Vorgehensweisen, z. B. abgestimmte Standard Operating Procedures (SOPs), für die Zielerreichung hilfreich?
• Werden die Präferenzen und Fähigkeiten der Teammitglieder optimal genutzt?
• Sind die Funktionen und Aufgaben im Team sinnvoll verteilt?
• Werden die vereinbarten Spielregeln, z. B. wöchentliche Teamsitzungen, eingehalten?
Details zur Entwicklung, Formulierung und Erreichung von Zielen sind im Kapitel 5 beschrieben ( 
Kap. 5
).
3.7.2 Lernpotenziale entwickeln
Die Arbeit im Team lernen die Mitglieder durch praktische Erfahrung. Um das Team jedoch weiterzuentwickeln, bedarf es strukturierter und geplanter Intervention der Leitung, die erst Lernprozesse der einzelnen Teammitglieder ermöglichen, denn im Laufe der Zeit ändern sich die Anforderungen an das Team.
 Lernmaßnahmen planen und umsetzen
Lernmaßnahmen planen und umsetzen 
Im ersten Schritt wird dazu der Lernbedarf ermittelt. Es ist Aufgabe der Leitungskraft zu prüfen, wer fachliches Wissen und Fertigkeiten noch auf den erforderlichen Standard im Team bringen muss und wer sich spezialisieren und höher qualifizieren kann. In Absprache mit dem Team werden im zweiten Schritt entsprechende Maßnahmen geplant. Im dritten Schritt geht es dann an die konkrete Umsetzung der geplanten Lernmaßnahmen. Im Idealfall entsteht so ein Fortbildungsplan für alle Teammitglieder mit 14-tägigen internen sowie externen Fortbildungen.
3.8 Teamführung – die Dynamik im Team konstruktiv nutzen
 Stärken und Schwächen der Teammitglieder kennen und berücksichtigen
Stärken und Schwächen der Teammitglieder kennen und berücksichtigen 
Ein Team ist keine amorphe Masse. Es besteht aus unterschiedlichen Einzelpersonen mit verschiedenen Persönlichkeitsprofilen und Reifegraden. Daher ist es völlig normal, dass jedes Team einer eigenen Dynamik unterliegt, die sich aus dem Zusammenspiel der einzelnen Teammitglieder ergibt. Für die Leitungskraft ist es wichtig, die Stärken und Entwicklungsmöglichkeiten ihrer Mitarbeitenden in fachlicher und sozialer Hinsicht genau beurteilen zu können, um ihr Team möglichst gut zu steuern.
Darüber hinaus hilft es der Leitung, die Rollen der einzelnen Teammitglieder einschätzen zu können. Denn in jedem Team gibt es Führer*innen, Förderer, Beschützer*innen und Bewahrer*innen. Gerade im Konfliktfall ist es notwendig, das Handeln der einzelnen Teammitglieder vor dem Hintergrund ihrer Rolle zu beurteilen, um aktiv und wirkungsvoll eingreifen zu können. Allerdings sollte die Leitungskraft im Konfliktfall nicht voreilig handeln, denn nicht aus jeder kleinen Reiberei wird gleich ein ausgewachsener Konflikt. Wenn sich jedoch abzeichnet, dass innerhalb des Teams keine Lösung möglich ist oder z. B. ein Teammitglied gezielt gemobbt wird, ist dringend das Eingreifen des Leitenden geboten. Das Ziel ist es, allen Teammitgliedern die Konfliktpotenziale und Ursachen bewusst zu machen.
Das Lösen von Konflikten ist nicht ausschließlich eine lästige Pflichtübung, sondern trägt maßgeblich zur Funktionsfähigkeit und Entwicklung des Teams bei (  Kap. 3.4.4).
Kap. 3.4.4).
3.8.1 Das funktionierende Team
 Vertrauen bestimmt die Leistungsfähigkeit des Teams
Vertrauen bestimmt die Leistungsfähigkeit des Teams 
In einem Top-Team herrscht eine Atmosphäre des Vertrauens. Es gehört zur Führungsaufgabe, die Impulse für ein positives Klima innerhalb des Teams zu setzen. Dazu gehört:
• Der Umgang miteinander ist ehrlich und aufrichtig.
• Die Aufgaben und Abläufe sind zuverlässig verteilt.
• Die Teammitglieder verfolgen ein gemeinsames Ziel.
• Es herrscht eine gut funktionierende Kommunikation.
• Veränderungen werden als Chance betrachtet.
• Probleme und Konflikte werden sofort geklärt.
Damit die Funktionsfähigkeit eines Teams erhalten bleibt, müssen die Binnenbeziehungen immer wieder überprüft werden. Mit einer Bindungsanalyse (  Kap. 1) kann die Führungskraft sehr leicht die Bindung zu einzelnen Teammitgliedern erheben.
Kap. 1) kann die Führungskraft sehr leicht die Bindung zu einzelnen Teammitgliedern erheben.
Je enger die einzelnen Teammitglieder zusammenstehen, umso leistungsfähiger ist das Team.
3.8.2 Riskante Teamdynamiken
Perfekt ist es, wenn eine neue Führungskraft ein motiviertes, positives und offenes Team übernimmt, das vorurteilsfrei und gerne den Arbeitsalltag gemeinsam meistert. Allerdings sieht die Realität oftmals anders aus.
Читать дальше
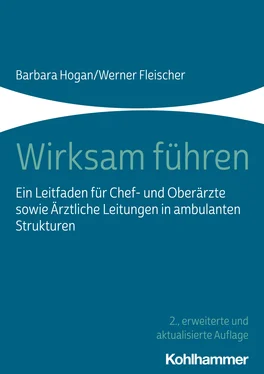
 Zielklarheit, Zieltransparenz und Zielverbindlichkeit bestimmen die Teamidentität
Zielklarheit, Zieltransparenz und Zielverbindlichkeit bestimmen die Teamidentität