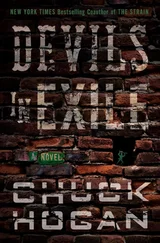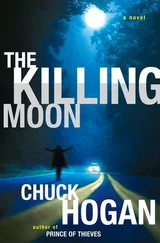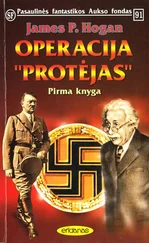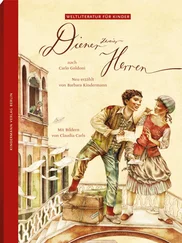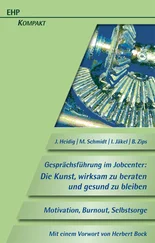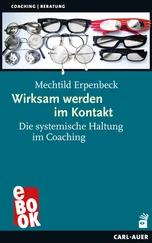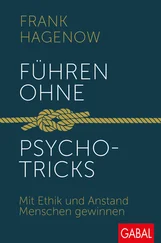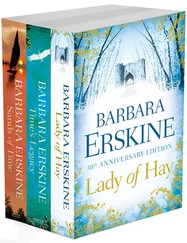1 ...8 9 10 12 13 14 ...24
Erwartungen der einzelnen Mitarbeitenden
Die Erwartungen der Mitarbeitenden beziehen sich einerseits auf die Beziehung zur Leitungskraft und sind andererseits aufgaben- und sachbezogen (Hofbauer, 2012). Grundsätzlich wünscht sich jede*r Mitarbeitende Anerkennung, Unterstützung, Anleitung, Verständnis, Gerechtigkeit und Feedback. Die Leitungskraft soll sicher auftreten und gleichzeitig entgegenkommend sein. Während das Team als Ganzes Gerechtigkeit erwartet, wünscht sich ein*e einzelne*r Mitarbeitende*r insgeheim ein klein wenig Bevorzugung (Hofbauer, 2012).
 Die Mitarbeitenden erwarten Anerkennung und Gerechtigkeit
Die Mitarbeitenden erwarten Anerkennung und Gerechtigkeit 
Bei einer Beförderung vom Assistenten zum Oberarzt erwarten die ehemaligen Kolleg*innen z. B., dass die neue Leitungskraft – wie früher auch – ein guter Kumpel ist und vielleicht schon mal ein Auge zudrückt. Für die Abnabelung vom alten Team ist für eine aus den eigenen Reihen rekrutierte Leitungskraft die offizielle Inthronisation wichtig. Damit wird ihre neue Rolle für alle Mitarbeitenden deutlich und sichtbar, sodass es ihnen leichter fällt, sich von alten Erwartungen zu lösen.
 Das Team erwartet ein gutes Zusammenspiel
Das Team erwartet ein gutes Zusammenspiel 
In Kliniken hat der Zusammenhalt im Team eine große Bedeutung. Die berufsgruppenübergreifende Zusammenarbeit steht im Vordergrund, das Handeln ist stark ergebnis- und prozessorientiert, in einigen Bereichen, z. B. in der Notaufnahme, ist die Überbetonung vorhandener hierarchischer Strukturen verpönt. Obwohl die Teams einer Station bzw. klinischer Abteilung aufgrund des Schichtsystems nur sehr selten gemeinsam anwesend sind, erwarten alle ein gutes Zusammenspiel, reibungslose Übergaben und funktionierenden Informationsfluss. Von der Leitungskraft wünschen sie sich Präsenz – unabhängig von der jeweiligen Schicht. Eine fest etablierte Besprechungsstruktur sowie die Informationsweitergabe in E-Mails und Protokollen sind wichtige Führungsinstrumente. Gleichzeitig erwarten die Mitarbeitenden von der Leitung, dass sie sich aktiv in das Tagesgeschäft einmischt und die Bodenhaftung nicht verliert. Von Leitungen, die die Position neu übernommen haben, erwartet das Team Problemlösungen, ohne zu tief in die Struktur einzugreifen. Gutes und Angenehmes sollen erhalten bleiben, Defizite und Mängel sollten beseitigt werden – und das alles bitte mit Vorsicht und Fingerspitzengefühl.
Erwartungen der Patient*innen und Angehörigen
 Patient*innen erwarten Einfühlungsvermögen
Patient*innen erwarten Einfühlungsvermögen 
Patient*innen und Angehörige nehmen die Schwere der Erkrankung sowie die geplanten medizinischen Maßnahmen und Behandlungsabläufe anders wahr als die Klinikmitarbeitenden. Ungeachtet der Tatsache, dass sie generell kurze Wartezeiten und eine möglichst hohe Behandlungsqualität erwarten, haben sie zwangsläufig eine andere Einstellung zu den medizinischen Maßnahmen und erwarten, dass sich Ärzt*innen und Pflegekräfte möglichst gut in ihre Situation und Sichtweise hineinfühlen. Abhängig von ihrem Persönlichkeitsprofil wünschen sich Patient*innen und ihre Angehörige ein an ihre individuellen Bedürfnisse angepasstes Maß an Information, Aufklärung, Beistand und Trost.
Die Zufriedenheit von Patient*innen und deren Angehörigen mit der medizinischen und sozialen Behandlung wird auch von der Klinikleitung erwartet – insbesondere in der Notaufnahme, die erheblichen Einfluss auf das Image der Klinik hat. Insofern werden Patient*innen zum Impulsgeber der Prozesse – bei gleichzeitiger Notwendigkeit der Beachtung wirtschaftlicher Rahmenbedingungen.
Erwartungen des familiären Umfelds
 Das familiäre Umfeld erwartet Zuwendung
Das familiäre Umfeld erwartet Zuwendung 
Zeitliche Belastungen aufgrund des Schichtdienstes, starke psychosoziale Beanspruchungen und ein hohes Maß an Verantwortung kennzeichnen die Tätigkeit in der Klinik. Nicht immer sind diese Tätigkeitsmerkmale mit den Erwartungen des familiären Umfeldes in Einklang zu bringen. Ausgesprochene und auch unausgesprochene Forderungen des familiären Umfelds, die mit dem Klinikalltag nur schwer zu vereinbaren sind, können schnell zu Rollenkonflikten führen. Allerdings basieren Lebenserfolg und -zufriedenheit langfristig nicht in erster Linie auf den Geschehnissen in der Klinik, sondern hauptsächlich auf der Unterstützung durch Familie und Partnerschaft.
Erwartungen an sich selbst
 Eigene Denk- und Verhaltensmuster bestimmen die Erwartungen an sich selbst
Eigene Denk- und Verhaltensmuster bestimmen die Erwartungen an sich selbst 
Die Erwartungen an sich selbst lassen sich am ehesten unmittelbar verändern. Es liegt an uns selbst, wie hoch wir die Messlatte legen. Allerdings wird die persönliche Erwartungshaltung stark von der eigenen Persönlichkeit sowie den Verhaltens- und Denkmustern beeinflusst. Zum Beispiel wird eine Leitungskraft, der es wichtig ist, bei ihren Mitarbeitenden beliebt zu sein, eher bereit sein, zugunsten ihres Teams zu entscheiden.
Je besser die Erwartungen an sich selbst reflektiert werden und die Faktoren bekannt sind, die diese Erwartungen bestimmen, umso einfacher ist es, eine Rolle anzunehmen und aktiv auszugestalten. Diese Klärung und Reflexion der eigenen Erwartungen ist insbesondere für Führungskräfte ein wichtiger Prozess.
2.2 Umgang mit Rollenkonflikten
Die Vielfalt dieser unterschiedlichen Erwartungen macht auch deutlich, dass Erfolg (als Leitungskraft) in enger Beziehung zu der Wahrnehmung und Bewertung des Umfeldes steht. Das heißt, Erfolg hängt nicht nur von konkreten Ereignissen ab, sondern auch von der Einschätzung des Rollenhandelns durch andere. Umso wichtiger ist es, die eigene Aufgabe und das Handeln klar darzustellen und Erfolge zu kommunizieren.
 Diskrepanz zwischen Erwartungen des Umfeldes und dem eigenen Handeln führt zu Rollenkonflikten
Diskrepanz zwischen Erwartungen des Umfeldes und dem eigenen Handeln führt zu Rollenkonflikten 
Je weniger die Erwartungen des Umfeldes mit dem eigenen Handeln übereinstimmen, desto stärker treten Rollenkonflikte zutage, sie können sich folgendermaßen darstellen (Neuberger, 1995):
Konflikte in der Person – Die Erwartungen an sich selbst sind widersprüchlich. Beispiel: Ein Oberarzt will im Team beliebt sein, will aber eine unpopuläre Entscheidung der Chefärztin durchsetzen.
Konflikte mit Mitarbeitenden oder anderen Funktionen – Die Erwartungen anderer widersprechen sich. Beispiel: Das Assistent*innen-Team erwartet Fairness und Gleichbehandlung bei der Verteilung der Dienste. Ein von familiären Problemen beeinträchtigter Kollege erwartet hingegen Rücksichtnahme und fordert zwei Dienste weniger.
Читать дальше
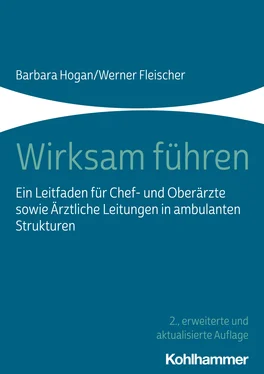
 Die Mitarbeitenden erwarten Anerkennung und Gerechtigkeit
Die Mitarbeitenden erwarten Anerkennung und Gerechtigkeit