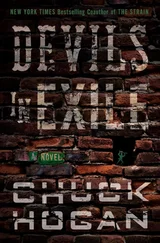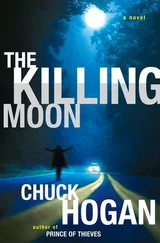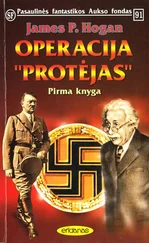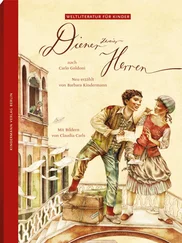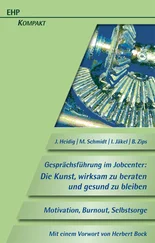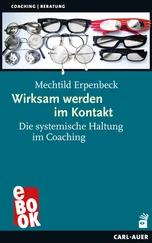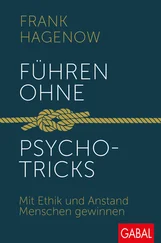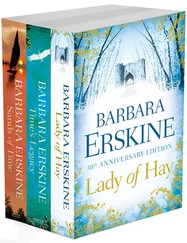1 ...7 8 9 11 12 13 ...24 • werden unter Umständen mit Fakten verwechselt.
• stehen teilweise in einem Widerspruch zueinander.
• sind die Messlatte für das Umfeld.
 Erwartungen der Umwelt bedürfen der Reflexion
Erwartungen der Umwelt bedürfen der Reflexion 
Für die Entwicklung eines klaren Rollenselbstbildes ist es wichtig, die Erwartungen, die das Umfeld an die Rolle hat, möglichst gut zu kennen und eine eigene Einstellung dazu zu entwickeln. Beruflicher Erfolg, insbesondere der von Leitungskräften, hängt in einem hohen Maße davon ab, wie auf die Erwartungen unterschiedlicher Personen und Gruppen reagiert wird: Welche Erwartungen nehme ich ernst, welche weniger und welche beachte ich nicht? Auf welche Erwartungen muss ich wie reagieren? Das sind die Kernfragen, mit denen sich Erwartungen priorisieren lassen.
Eines sollte dabei klar sein: Alle Erwartungen sind nicht zu erfüllen. Aber je genauer man die Erwartung an die Rolle kennt, umso besser kann das Verhalten der Umwelt eingeschätzt und desto besser kann dazu eine eigene Position bezogen werden. Eine solche Rollenreflexion schützt zum einen davor, sich von den Erwartungen anderer verunsichern zu lassen. Zum anderen verhindert sie, sich einseitig auf eine Position einzulassen, ohne die Auswirkungen auf andere zu bedenken (Hofbauer, 2012).
2.1.2 Rollenkomplexität – im Spannungsfeld unterschiedlicher Erwartungen
 Analyse der Rollenerwartungen
Analyse der Rollenerwartungen 
Fragt man Mediziner*innen nach ihrem Rollenverständnis, sehen sie sich in erster Linie als Menschen im Dienst der Gesundheit, die zum Wohle ihrer Patient*innen tätig sind. Doch Ärzt*innen, die im aktuellen gesundheitspolitischen Umfeld in einer Klinik arbeiten und dort eine Leitungsposition innehaben, managen als Schnittstellenverantwortliche weitreichende Prozesse. In jedem Einzelfall sind sie für die diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen verantwortlich und müssen dafür zu sorgen, dass Patient*innen ggf. in andere klinische Abteilungen weitergeleitet werden. Gleichzeitig dürfen sie die damit verbundenen ökonomischen Aspekte nicht aus den Augen verlieren und müssen ihrer Dokumentationsverpflichtung nachkommen. Aus dieser komplexen und anspruchsvollen Arbeitsaufgabe resultieren viele Rollenerwartungen unterschiedlicher Personengruppen:
Erwartungen …
• der Geschäftsführung, der Ärztlichen bzw. kaufmännischen Leitung
• der Kolleg*innen anderer Stationen/Kliniken
• anderer Berufsgruppen
• der einzelnen Mitarbeitenden
• des Teams
• der Patient*innen und Angehörigen
• des familiären Umfeldes
• an sich selbst
 Rollenkonflikte
Rollenkonflikte 
Bei dieser Vielzahl unterschiedlicher Erwartungen entstehen beinahe zwangsläufig Situationen, in denen Erwartungen nicht erfüllt werden können oder sich widersprechen. Die Folge sind Rollenkonflikte.
Ein Beispiel aus der Notaufnahme: Ein Patient mit unklaren Schmerzen im Brustbereich wird in die Notaufnahme eingeliefert. Er erwartet eine schnelle und umfassende Diagnose und Therapie unter Einbeziehung aller zur Verfügung stehenden Mittel. Der Notfallmediziner hat die Erwartung an sich selbst, eine möglichst gut abgesicherte Diagnose zu stellen. Aus medizinischer Sicht wäre dafür die Erhebung mehrerer kostenintensiver Laborwerte hilfreich, jedoch ist diese Maßnahme aus Kostengründen nur in Ausnahmefällen vorgesehen. Die Kaufmännische Leiterin erwartet eine möglichst kostengünstige Behandlung. Es prallen drei unterschiedliche, sich zum Teil widersprechende Erwartungen aufeinander.
Der Umgang mit einer großen Rollenkomplexität und den damit verbundenen unterschiedlichen Rollenerwartungen ist mit dem Berufsbild eines/einer Mediziner*in unweigerlich verbunden – auch die Tatsache, dass daraus mitunter Rollenkonflikte entstehen. Wer sich der Herausforderung, die dieser Beruf mit sich bringt, stellen will, sollte sich diesen Umstand bewusst machen und die unterschiedlichen Erwartungen möglichst genau kennen, um eine eigene Position dazu zu entwickeln. Im Folgenden werden die wichtigsten Erwartungen kurz skizziert.
Erwartungen der Geschäftsführung, der Ärztlichen und kaufmännischen Leitung
 Geschäftsführer*innen erwarten kaufmännische Kompetenz
Geschäftsführer*innen erwarten kaufmännische Kompetenz 
Eine Geschäftsführung hat die Interessen der gesamten Klinik im Blick. Sie ist für das finanzielle Gesamtergebnis verantwortlich und muss für die Erreichung der Klinikziele sorgen. Das Bestreben ist es, das Zusammenwirken der einzelnen Bereiche möglichst so zu organisieren, dass der langfristige Erfolg der Klinik gesichert ist. Im Fokus ihrer Aufmerksamkeit steht daher die gesamte Organisation.
Von den Mitarbeitenden in den Fachkliniken bzw. deren Leitung wird erwartet, dass sie …
• sich mit den Klinikzielen identifizieren,
• auf hohem fachlichen Niveau arbeiten,
• Qualitätsstandards einhalten,
• ihren Arbeitsbereich sicher beherrschen,
• patientenorientierte Versorgung leisten und dabei auf Wirtschaftlichkeit achten,
• klinik- bzw. stationsübergreifend gut zusammenarbeiten,
• interdisziplinär und interprofessionell zusammenarbeiten,
• sparsam mit den Ressourcen Zeit und Geld umgehen,
• Konflikte alleine lösen.
Bei der Bewertung einer Situation stellen sich Geschäftsführer*innen immer die Frage: Wie wirkt sich diese Entscheidung auf die gesamte Klinik bzw. auf das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) der Klinik aus?
Vor diesem Hintergrund fordern Geschäftsführer*innen und ärztliche Direktor*innen von der Leitung einer klinischen Abteilung kaufmännisches Denken und Handeln.
Erwartungen der Leitungskräfte/ärztlichen Kolleg*innen anderer Stationen bzw. Kliniken
Die Leitungskräfte bzw. Kolleg*innen anderer Stationen erwarten kollegiales Verhalten, Kooperationsbereitschaft und Informationsweitergabe. Der eigene Bereich soll dabei weitgehend unangetastet bleiben, »Hineinregieren« wird nicht geduldet. Allzu forsches Auftreten oder Allianzen in Richtung Klinikleitung sind verpönt. Hingegen erwarten sie gegenüber der Klinikleitung ein möglichst gemeinsames und solidarisches Auftreten.
 Mitarbeitende anderer Klinikbereiche erwarten Kollegialität
Mitarbeitende anderer Klinikbereiche erwarten Kollegialität 
Wer neu in der Leitungsposition ist, sollte daher erst einmal die Bereitschaft zu solidarischem Handeln signalisieren und sich in Einzelgesprächen mit den Erwartungen der Kolleg*innen vertraut machen. Jedoch gilt es, das schnelle Verbünden zu vermeiden. Vorher sollte erst analysiert werden, welche Erwartungen und welche Positionen die anderen Leitungskolleg*innen haben und worin die eigenen Ziele bestehen.
Читать дальше
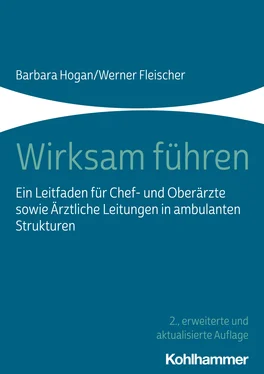
 Erwartungen der Umwelt bedürfen der Reflexion
Erwartungen der Umwelt bedürfen der Reflexion