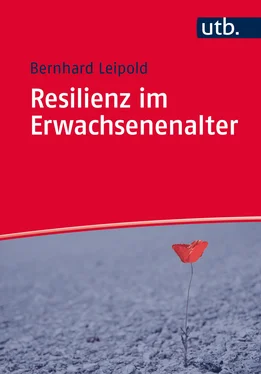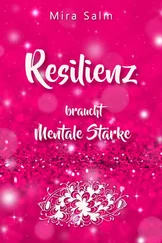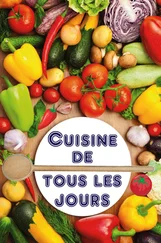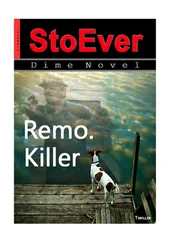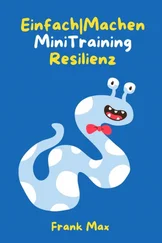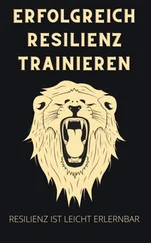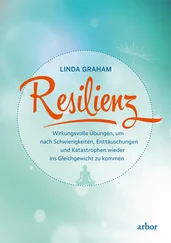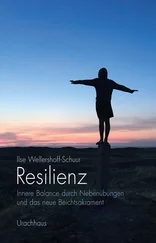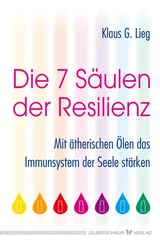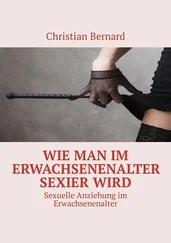Bernhard Leipold - Resilienz im Erwachsenenalter
Здесь есть возможность читать онлайн «Bernhard Leipold - Resilienz im Erwachsenenalter» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Resilienz im Erwachsenenalter
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Resilienz im Erwachsenenalter: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Resilienz im Erwachsenenalter»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Resilienz ist in mehreren Fächern der Psychologie ein wichtiges Thema und auch außerhalb der Universi …
Resilienz im Erwachsenenalter — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Resilienz im Erwachsenenalter», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
1.3 Historische Vorläufer und verwandte Konzepte
Der Begriff Ich-Resilienz (ego-resiliency) wurde zusammen mit der Ich-Kontrolle (ego-control) in der Psychologie bereits in den 1950er Jahren von Jack Block verwendet (Letzring et al., 2005).
Ich-Kontrolle
Die Ich-Kontrolle bezieht sich auf die Hemmung bzw. den Ausdruck von Impulsen, worin sich Personen mitunter deutlich unterscheiden, und variiert zwischen den Dimensionen der Über- bzw. Unterkontrolle. Überkontrollierte Personen halten ihre Impulse und affektiven Reaktionen in der Grundtendenz eher zurück. Sie haben Schwierigkeiten, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, schieben Belohnungen auf und sind in der Lage, Aufgaben über einen langen Zeitraum hinweg zu verfolgen, ohne sich ständig ablenken zu lassen. Sie haben sich bzw. ihre unmittelbaren Reaktionen „unter Kontrolle“, was je nach Situation vorteilhaft, aber auch mit Nachteilen verbunden sein kann. Unterkontrollierte Menschen reagieren hingegen oftmals eher impulsiv und spontan, d.h. sie sind emotional schnell erregbar, aufbrausend, eingeschnappt oder erfreut. Inwieweit das jeweils sozial angemessen ist, sei dahingestellt. Sie bevorzugen eher unmittelbare Belohnungen und lassen sich schneller ablenken.
Ich-Resilienz
Die sog. Ich-Resilienz wurde als eine weitere zentrale Facette der Persönlichkeit vorgestellt, welche die dynamische Fähigkeit von Personen bezeichnet, das Ausmaß an Ich-Kontrolle zu verändern, wenn es die Situation erfordern sollte. Sie können ihre Impulsivität anpassen, was vielfach vorteilhafter erscheint als das Verharren in einer Reaktionstendenz. Auf eine solche adaptive Kapazität bzw. Flexibilität wird noch ausführlich eingegangen, weil die Idee der Anpassung für Resilienz von zentraler Bedeutung ist.
hardiness
Ein weiteres Persönlichkeitsmerkmal, auf das in der Resilienzforschung häufig verwiesen wird (Knoll et al., 2013), ist die hardiness (Widerstandsfähigkeit; Kobasa, 1979; Maddi, 2013). Kobasa verglich zwei Gruppen von Männern, die zwar ein vergleichbares, hohes Ausmaß an kritischen Lebensereignissen erlebt hatten, aber einen unterschiedlichen Gesundheitszustand berichteten, der über eine Krankheitsliste erhoben wurde. Es zeigte sich, dass die Gruppe mit viel Stress und wenig Krankheiten (die Resilienten) über mehr Selbstverpflichtung (commitment) sowie mehr internale Kontrollüberzeugungen (control) verfügten und Veränderungen als Herausforderung (challenge) interpretierten. Dieses Persönlichkeitsmuster bezeichnete Kobasa als hardiness.
Persönlichkeitstheoretische Zugänge zeigen also unterschiedliche Merkmale (z.B. Kompetenzen, Fähigkeiten) auf, über die Personen mehr oder weniger verfügen und die zur Erklärung von Resilienz herangezogen werden. Dabei stellt sich allerdings auch die Frage nach deren Entwicklung und Beeinflussbarkeit. Maddi (2013) spricht von einem Muster von Einstellungen und Strategien (bestehend aus commitment, control, challenge), die alle drei hardiness konstituieren. Sie können seiner Ansicht nach durch die soziale Unterstützung von Eltern oder Mentoren erlernt werden, sie sind also veränderbar.
Coping
Hardiness im Verständnis Maddis weist Ähnlichkeiten mit Bewältigungsformen auf, die als problemorientiertes Coping bezeichnet wurden (Folkman & Lazarus, 1980). Vermeidende Bewältigungsformen und Verdrängung des Problems wären der gegenteilige Pol. Der Begriff „Coping“ wird sehr häufig in der neutralen Form verwendet (Wentura et al., 2002), d.h. Menschen wenden unterschiedliche Bewältigungsformen an, aber inwieweit dies mit Erfolg verbunden ist, ist eine offene empirische Frage.
Sehr häufig wird in Anlehnung an Lazarus und Folkman zwischen problemorientiertem und emotionsorientiertem Coping unterschieden (Smith & Kirby, 2011). Im ersten Fall sind Strategien gemeint, die das Problem beseitigen, im zweiten Fall handelt es sich um Bewältigungsformen, welche die emotionalen Reaktionen auf Stress verändern oder lindern. Wenn man die beiden Formen einander gegenüberstellt, wird man vielleicht schnell geneigt sein, der Problembeseitigung den Vorzug zu geben und die emotionale Bewältigung als die Form zweiter Wahl anzusehen. Gerne wird auch die Fuchsfabel so interpretiert: Besser wäre es doch, er käme an die Trauben ran! Dass er sich denkt, dass die Trauben sauer sind und deswegen seine Unzulänglichkeit nicht beklagen muss, ist nicht viel mehr als ein Zugeständnis, das aus der Not eine Tugend macht. Wenn man die (künstliche) Dichotomie so aufspannt, ist es verständlich, dass viele in der Tat dazu tendieren, die selbstgestalterische Kraft und Potenz zu bevorzugen und die Akzeptanz ihres Schicksals denjenigen zu überlassen, die zu mehr nicht in der Lage sind. Dass es Formen der Stressbewältigung gibt, die in jeder Situation anderen überlegen wären oder generell als günstig bezeichnet werden können, ist jedoch mit guten Gründen bezweifelt worden (Greve, 2008). Wir werden in Kapitel 3noch ausführlicher darauf eingehen, wenn es um die adaptiven Prozesse geht, die zu Resilienz führen.
Stadien der Resilienzforschung
Die psychologische Resilienzforschung hat während der letzten Jahrzehnte unterschiedliche Schwerpunkte durchlaufen und eine Reihe von wichtigen Fragen untersucht. Gerade wurde das vierte Forschungsstadium durchschritten, wenn man der Zählung von Masten folgt (Masten & Wright, 2010). In den frühen Studien stand noch im Vordergrund, wodurch Resilienz charakterisiert ist, wie sie definiert und gemessen werden kann. Darauf folgte eine Fokussierung der Prozesse, die zu Resilienz führen (die Wie-Frage nach der Funktion). In einem dritten Stadium verfolgte man die Fragestellung, wie durch geeignete Interventionen die dafür nötigen Kompetenzen und skills gefördert werden können. In jüngster Zeit wurden schließlich vermehrt die Einflüsse von genetischen und neurologischen Faktoren auf die Entwicklung von Resilienz untersucht. Während man sich in den frühen Studien zu Resilienz häufig auf die Kindheit und die Untersuchung von Persönlichkeitsunterschieden konzentrierte, erfuhr das Forschungsfeld schließlich auch eine theoretische und empirische Ausweitung auf die gesamte Lebensspanne (Greve & Staudinger, 2006; Staudinger et al., 1995).
biologische Stresskonzepte
Der amerikanische Physiologe Walter Cannon und der in Wien gebürtige Mediziner Hans Selye begründeten die Stressforschung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts (Cannon, 1932; Selye, 1936), noch bevor es ein Resilienzkonzept gab, wie es heute in der Psychologie verwendet wird. Beide interessierten sich vor allem für neurobiologische Abläufe in Stress- oder Gefahrensituationen.
Cannon prägte das Fight-or-flight-Syndrom, das die schnellen und unmittelbaren körperlichen und psychischen Anpassungsformen in Gefahrensituationen beschreibt. Kämpfen oder die Flucht ergreifen sind Reaktionsformen eines Organismus, bei denen Energie für ein Verhalten bereitgestellt wird, welches das Überleben in Gefahrensituationen sichert.
Hans Selye entwickelte in den 1930er Jahren die Grundlagen für die Stressforschung (Szabo et al., 2012). Er begründete den Begriff Stress und das allgemeine Adaptationssyndrom, ein Reaktionsmuster auf länger anhaltenden Stress. Ist ein Organismus längere Zeit Stressoren (z.B. Hunger, Hitze, Leistungsdruck etc.) ausgesetzt, kann dies kurzfristig zu einer erhöhten Widerstandskraft führen, langfristig jedoch zu körperlichen Schäden und Erschöpfung. Stresshormone wie Adrenalin und Cortisol sowie körperliche Anpassungsreaktionen verursachen zwar eine erhöhte Leistungsbereitschaft, aber ihre Aufrechterhaltung kostet den Organismus Kraft. Körperliche Anpassungen von Lebewesen in Gefahrensituationen als Stressreaktion beinhalten die Freisetzung von Adrenalin sowie Veränderungen des Herzschlags, der Atmungsfrequenz und der Muskelanspannung. Eine Dauerbelastung führt zum Nachlassen der Körperkraft und zum Zusammenbruch des Organismus. Die Funktionstüchtigkeit der biologischen Prozesse ist aus der biologischen Perspektive wesentliches Kennzeichen von Resilienz.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Resilienz im Erwachsenenalter»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Resilienz im Erwachsenenalter» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Resilienz im Erwachsenenalter» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.